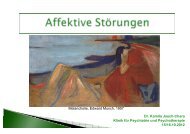Empfehlungen zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie ...
Empfehlungen zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie ...
Empfehlungen zur kalkulierten parenteralen Initialtherapie ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>kalkulierten</strong> <strong>parenteralen</strong> <strong>Initialtherapie</strong> bakterieller Erkrankungen bei Erwachsenen – Update 2010<br />
anschließende erneute Probengewinnung<br />
einer unklaren, resistente Erreger selektionierenden<br />
und möglicherweise toxischen<br />
Fortsetzung der Therapie vorzuziehen.<br />
Von der Systematik her lassen sich drei<br />
verschiedene Formen der Peritonitis differenzieren,<br />
die sich kausal pathogenetisch,<br />
bezüglich des Erregerspektrums und der<br />
chirurgischen und antimikrobiellen Therapie<br />
substanziell unterscheiden [32].<br />
Primäre Peritonitis<br />
Die primäre (spontan bakterielle) Peritonitis<br />
(SBP) betrifft nur etwa 1 % aller Peritonitisfälle.<br />
Bei der juvenilen Form handelt<br />
es sich um eine hämatogen entstandene<br />
Infektion, die durch Streptokokken, Pneumokokken<br />
oder in seltenen Fällen durch<br />
Haemophilus influenzae ausgelöst wird.<br />
Beim Erwachsenen sind vorwiegend Patienten<br />
mit Aszites bei Leberzirrhose (ca.<br />
70 %) oder einer reduzierten Abwehrlage<br />
aus anderer Ursache (ca. 30 %) betroffen<br />
[22, 52]. Meist handelt es sich um eine<br />
Monoinfektion. In realitätsnahen Arbeiten<br />
gelingt nur in etwa 35 % der Fälle ein Erregernachweis,<br />
wobei sich Escherichia coli,<br />
Klebsiella spp., Staphylokokken, Enterokokken<br />
oder Streptokokken, gelegentlich<br />
auch pathogene Darmbakterien wie Aeromonas<br />
spp. oder Salmonella spp., nachweisen<br />
lassen [22]. Bei der primären Peritonitis,<br />
die im Rahmen einer Tuberkulose<br />
auftreten kann, handelt es sich um eine<br />
hämatogene Streuung.<br />
Randomisierte Studien <strong>zur</strong> Behandlung<br />
der SBP sind rar. Meist handelt es<br />
sich um retrospektive Arbeiten. Eingesetze<br />
Substanzen waren Ceftriaxon, Cefo-<br />
taxim, Ceftazidim sowie Acylaminopenicilline<br />
mit Beta-Lactamase-Inhibitor (BLI) [10]<br />
(Tabelle 7.1.). Damit ließen sich zusammen<br />
mit der Gabe von Albumin klinische<br />
Heilungsraten von etwa 80 % erzielen<br />
[55].<br />
Peritonitis bei CAPD<br />
Eine Peritonitis bei kontinuierlicher ambulanter<br />
Peritonealdialyse (CAPD) wird in der<br />
Regel durch Kontamination des Schlauch-<br />
oder Kathetersystems verursacht. Häufigste<br />
Erreger sind Koagulase-negative Staphylokokken<br />
und Staphylococcus aureus.<br />
Seltener werden E. coli, Enterokokken,<br />
Streptokokken, Pseudomonas aeruginosa,<br />
Anaerobier, Enterobacter spp. oder Candida-Arten<br />
nachgewiesen [57]. Unkomplizierte<br />
Fälle können lokal durch Zugabe<br />
antimikrobieller Substanzen <strong>zur</strong> Dialysierflüssigkeit<br />
behandelt werden. Nur bei den<br />
selteneren schweren Verlaufsformen wird<br />
neben der intraperitonealen auch eine<br />
parenterale Therapie notwendig. Dabei<br />
müssen die Besonderheiten der Antibiotika-Dosierung<br />
bei Niereninsuffizienz<br />
beachtet werden.<br />
Zur <strong>kalkulierten</strong> Therapie wird ein<br />
Cephalosporin der Gruppe 2 mit oder<br />
ohne Ciprofloxacin empfohlen [35]. Die<br />
Therapie sollte nach den Ergebnissen der<br />
mikrobiologischen Diagnostik gezielt fortgeführt<br />
werden. Bei Nachweis von MRSA,<br />
MRSE und Enterokokken (inkl. VRE) stehen<br />
die Antibiotika gemäß Tabelle 7.4. <strong>zur</strong><br />
Verfügung. Wird die Infektion nicht binnen<br />
einer Woche durch die antimikrobielle<br />
Therapie beherrscht, muss der Peritoneal-<br />
Dialyse-Katheter entfernt werden [61].<br />
Tab. 7.1. <strong>Empfehlungen</strong> <strong>zur</strong> <strong>Initialtherapie</strong> der primären Peritonitis und der CAPD-Peritonitis<br />
Sekundäre Peritonitis<br />
Die sekundäre Peritonitis, bei der eine Perforation<br />
des Gastrointestinaltrakts vorliegt,<br />
ist mit etwa 80 bis 90 % die mit Abstand<br />
häufigste IAI. Definitionsgemäß muss eine<br />
chirurgische Herdsanierung (z. B. Appendektomie<br />
bei perforierter Appendizitis)<br />
stattfinden. Zunehmend setzt sich die primäre<br />
Herdsanierung mit anschließendem<br />
definitivem Verschluss des Abdomens und<br />
klinischer Verlaufskontrolle des Patienten<br />
durch [26, 59]. Die sekundäre Peritonitis<br />
kann differenziert werden in eine ambulant<br />
erworbene (ca. 70 %) und eine postoperative<br />
(ca. 30 %) Form.<br />
Ambulant erworbene<br />
sekundäre Peritonitis<br />
Bei der ambulant erworbenen sekundären<br />
Peritonitis liegt stets eine Mischinfektion<br />
vor. Das Erregerspektrum entstammt<br />
der Flora des Magen-Darm-Trakts und ist<br />
abhängig von der Pathogenese und der<br />
Lokalisation der Perforation bzw. Leckage.<br />
Leitkeime sind E. coli, Bacteroides fragilis,<br />
Enterokokken und Candida spp.<br />
Neben chirurgischen Maßnahmen wird<br />
eine kalkulierte <strong>Initialtherapie</strong> eingeleitet,<br />
die möglichst bereits präoperativ begonnen<br />
werden muss.<br />
Die vorliegenden <strong>Empfehlungen</strong><br />
berücksichtigen die Dauer der Erkrankung<br />
und das Erregerspektrum in Abhängigkeit<br />
von der Krankheitsursache [61]. Zur Antibiotika-Therapie<br />
von lokal begrenzten,<br />
akuten Peritonitiden können Aminopenicilline/BLI,<br />
Acylaminopenicilline/BLI, Carbapeneme<br />
Gruppe 2, alternativ Cepha-<br />
Diagnose Meist Monoinfektion <strong>Initialtherapie</strong> Dauer EVG EG<br />
Juvenile Peritonitis A-Streptokokken<br />
Pneumokokken<br />
Seltener: Haemophilus influenzae<br />
Peritonitis bei<br />
Leberzirrhose<br />
(Monoinfektion)<br />
Escherichia coli<br />
Enterokokken<br />
Klebsiella spp.<br />
Aminopenicillin/BLI<br />
Acylaminopenicillin/BLI<br />
Cephalosporin Gruppe 2<br />
Cephalosporin Gruppe 3a<br />
Fluorchinolon Gruppe 2<br />
Acylaminopenicillin/BLI<br />
Peritonitis bei TBC Mykobakterien Kombinationstherapie nach<br />
Testung<br />
Peritonitis bei CAPD Staphylokokken<br />
Escherichia coli<br />
Enterokokken<br />
Andere Streptokokken<br />
Enterobacteriaceae<br />
Pseudomonas spp.<br />
Acinetobacter spp.<br />
MRSA, VRE<br />
ESBL-Bildner<br />
Candida spp.<br />
Cephalosporin Gruppe 2 ±<br />
Fluorchinolon Gruppe 2<br />
siehe Tabelle 7.4.<br />
siehe Tabelle 7.4.<br />
siehe Tabelle 7.2.<br />
EVG: Evidenzgrad; EG: Empfehlungsgrad; BLI: Beta-Lactamase-Inhibitor<br />
7 Tage A<br />
A<br />
A<br />
5 – 7 Tage A<br />
A<br />
A<br />
> 6 Monate<br />
III<br />
III<br />
III<br />
la<br />
la<br />
lb<br />
A lla<br />
47


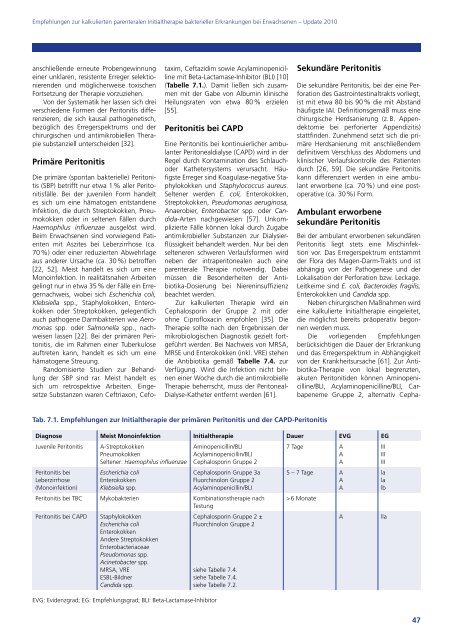
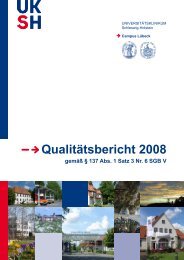



![Ausgabe Januar 2013 [pdf] - UKSH Universitätsklinikum Schleswig ...](https://img.yumpu.com/11131115/1/184x260/ausgabe-januar-2013-pdf-uksh-universitatsklinikum-schleswig-.jpg?quality=85)
![Qualitätsbericht 2011 Campus Kiel [PDF] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/9884717/1/184x260/qualitatsbericht-2011-campus-kiel-pdf-uksh-.jpg?quality=85)
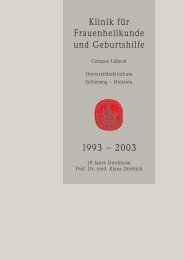

![Interdisziplinäres Symposium Inkontinenz am 24.9.08 [pdf] - UKSH ...](https://img.yumpu.com/7718861/1/190x135/interdisziplinares-symposium-inkontinenz-am-24908-pdf-uksh-.jpg?quality=85)