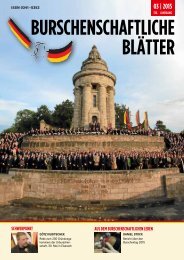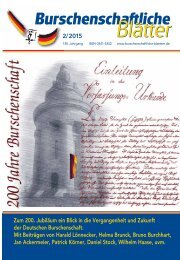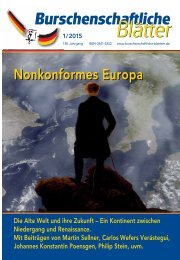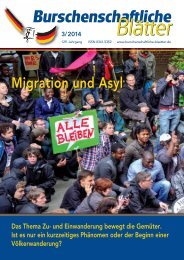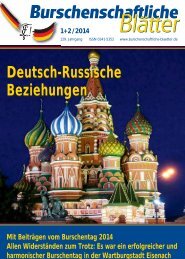Burschenschaftliche Blätter 2014 - 4
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aus dem burschenschaftlichen Leben<br />
sogenannten Naturzustand, frei von gesellschaftlichen<br />
Bindungen, dem Pufendorf<br />
eine unveräußerliche Würde zuerkannte,<br />
die sich allein aus der Natur des Menschen<br />
ergeben sollte, da dieser die Gabe der Vernunft<br />
und des freien Willens besaß und sich<br />
– anders als die anderen Lebewesen – ein<br />
Urteil über „gut“ und „böse“ bilden<br />
konnte. Jeder sollte aber den anderen in<br />
gleicher Weise ansehen und behandeln. Im<br />
sogenannten „status naturalis“ bestand<br />
zwar eine natürliche Freiheit, dennoch war<br />
der Mensch in diesem Zustand hilflos, daher<br />
war der Staat als ordnende Institution<br />
erforderlich. Darauf aufbauend entwickelte<br />
Christian Thomasius (1655–1728) ein<br />
Staatsverständnis zur Stärkung der Souveränität<br />
des Landesfürsten. Dieser sollte die<br />
Glückseligkeit des einzelnen regeln, die individuellen<br />
und die gesellschaftlichen Interessen<br />
sollten dabei berücksichtigt, aber<br />
ausgeglichen werden. Das Naturrecht<br />
wurde bei ihm zur Frage der inneren Vernunft,<br />
das positive Recht war bindend und<br />
das natürliche Recht galt als Gewissensverpflichtung.<br />
Somit schwächte Thomasius<br />
auch wieder die Bindungskraft des Naturrechts.<br />
Christian Wolff (1679–1754), frühester<br />
Verfechter des modernen freiheitlichen<br />
Rechtsstaats, dennoch Kritiker einer modernen<br />
Demokratie unter Mitwirkung des<br />
aus seiner Sicht noch zu unreifen Volkes, ermöglichte<br />
dennoch erstmals eine ausführliche<br />
und nahtlos ineinandergreifende systematische<br />
Darstellung von Freiheitsrechten,<br />
wodurch er auch auf die nordamerikanischen<br />
Menschenrechtserklärungen einwirkte.<br />
Das deutsche Naturrecht war zwar<br />
nicht revolutionär, aber staatswandelnd.<br />
Anschließend waren Verbindungen zu Kant<br />
erklärbar.<br />
Nach der Auflösung des Heiligen Römischen<br />
Reiches Deutscher Nation im Jahr<br />
1806, in dem vor allem zwei Großmächte,<br />
<strong>Burschenschaftliche</strong><br />
<strong>Blätter</strong><br />
Der damalige 3. Nationalratspräsident Martin Graf bei seiner Begrüßungsan -<br />
sprache.<br />
Parlamentsdirektion/Bildagentur Zolles KG/<br />
Mike Ranz<br />
nämlich Habsburg<br />
und Preußen, miteinander<br />
rivalisiert<br />
hatten, kam es zur<br />
weit verbreiteten<br />
Fürstenwillkür in<br />
den einzelnen<br />
Kleinstaaten, vergleichbar<br />
mit einem<br />
Flickenteppich, den<br />
seit 1815 bis 1866<br />
in Frankfurt am<br />
Main die Bundesversammlung<br />
des<br />
Deutschen Bundes<br />
zusammenhielt. Der<br />
Deutsche Bund war<br />
kein Parlament im<br />
modernen Sinn,<br />
sondern ein Gesandtengremium<br />
von 39 souveränen<br />
Bundesstaaten, zu<br />
denen auch die vier<br />
Freien Städte<br />
gehörten. In einigen<br />
dieser Einzelstaaten<br />
fanden damals<br />
schon die ersten<br />
Diskussionen<br />
um eine Modernisierung<br />
der Verfassung<br />
unter besonderer<br />
Berücksichtigung<br />
von Grundrechten<br />
statt, so im<br />
damaligen Herzogtum<br />
Nassau (heute<br />
zum Bundesland<br />
Hessen gehörend). Freiherr vom Stein<br />
(1757–1831) als einer der ersten Wortführer<br />
hatte damals großen Anteil am Zustandekommen<br />
dieser Verfassung, und er wurde<br />
unterstützt von jungen Leuten, die sich entweder<br />
zu den damaligen „Deutschen Gesellschaften“,<br />
zum Hoffmann’schen Bund<br />
sowie zu den ersten Burschenschaften beziehungsweise<br />
zu den „Gießener<br />
Schwarzen“ bekannten. Deren Hauptvertreter,<br />
die Brüder August Adolf und Karl<br />
Follen, nahmen weitestgehend Einfluß auf<br />
die Verfassungsentwicklung, vor allem in<br />
Nassau und in Hessen-Darmstadt. Sie fühlten<br />
sich wie die Anhänger der am 12. Juni<br />
1815 in Jena gegründeten Deutschen Burschenschaft<br />
ganz dem freiheitlichen Geist<br />
verpflichtet. Die Burschenschafter waren<br />
beeinflußt durch die Spätfolgen der Französischen<br />
Revolution und die daraus resultierende<br />
Rechts- und Verfassungsentwicklung,<br />
forderten die nationale Einheit<br />
Deutschlands, die Beseitigung von Partikularismus<br />
und Selbstherrlichkeit der Souveräne,<br />
die Partizipation des Volkes und die<br />
sogenannte „Preßfreiheit“. Das waren alles<br />
Optionen, die später, in den Jahren<br />
1848/49, in den Mittelpunkt rückten.<br />
Die Dinghofer-Medaille.<br />
Parlamentsdirektion/Bildagentur Zolles KG/Mike Ranz<br />
1817 jährte sich zum 300. Mal das Reformationsfest,<br />
was die Jenaischen Studenten<br />
dazu veranlaßte, die Wartburg zum Schauplatz<br />
des ersten deutschen Nationalfestes<br />
zu wählen. Der eigentliche Grund war jedoch<br />
der vierte Jahrestag der Leipziger<br />
Völkerschlacht, daher die Festlegung auf<br />
Heft 4 - <strong>2014</strong> 131