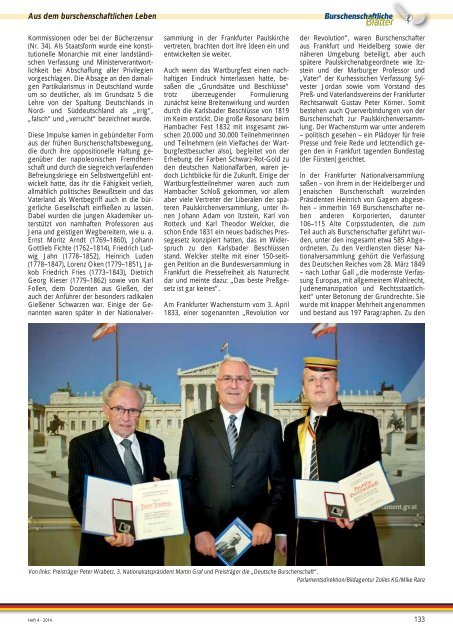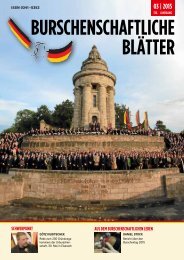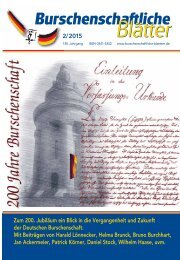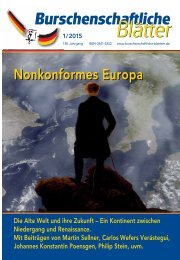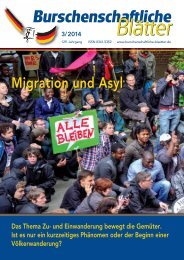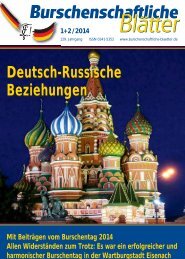Burschenschaftliche Blätter 2014 - 4
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aus dem burschenschaftlichen Leben<br />
Kommissionen oder bei der Bücherzensur<br />
(Nr. 34). Als Staatsform wurde eine konstitutionelle<br />
Monarchie mit einer landständischen<br />
Verfassung und Ministerverantwortlichkeit<br />
bei Abschaffung aller Privilegien<br />
vorgeschlagen. Die Absage an den damaligen<br />
Partikularismus in Deutschland wurde<br />
um so deutlicher, als im Grundsatz 5 die<br />
Lehre von der Spaltung Deutschlands in<br />
Nord- und Süddeutschland als „irrig“,<br />
„falsch“ und „verrucht“ bezeichnet wurde.<br />
Diese Impulse kamen in gebündelter Form<br />
aus der frühen Burschenschaftsbewegung,<br />
die durch ihre oppositionelle Haltung gegenüber<br />
der napoleonischen Fremdherrschaft<br />
und durch die siegreich verlaufenden<br />
Befreiungskriege ein Selbstwertgefühl entwickelt<br />
hatte, das ihr die Fähigkeit verlieh,<br />
allmählich politisches Bewußtsein und das<br />
Vaterland als Wertbegriff auch in die bürgerliche<br />
Gesellschaft einfließen zu lassen.<br />
Dabei wurden die jungen Akademiker unterstützt<br />
von namhaften Professoren aus<br />
Jena und geistigen Wegbereitern, wie u. a.<br />
Ernst Moritz Arndt (1769–1860), Johann<br />
Gottlieb Fichte (1762–1814), Friedrich Ludwig<br />
Jahn (1778–1852), Heinrich Luden<br />
(1778–1847), Lorenz Oken (1779–1851), Jakob<br />
Friedrich Fries (1773–1843), Dietrich<br />
Georg Kieser (1779–1862) sowie von Karl<br />
Follen, dem Dozenten aus Gießen, der<br />
auch der Anführer der besonders radikalen<br />
Gießener Schwarzen war. Einige der Genannten<br />
waren später in der Nationalversammlung<br />
in der Frankfurter Paulskirche<br />
vertreten, brachten dort ihre Ideen ein und<br />
entwickelten sie weiter.<br />
Auch wenn das Wartburgfest einen nachhaltigen<br />
Eindruck hinterlassen hatte, besaßen<br />
die „Grundsätze und Beschlüsse“<br />
trotz überzeugender Formulierung<br />
zunächst keine Breitenwirkung und wurden<br />
durch die Karlsbader Beschlüsse von 1819<br />
im Keim erstickt. Die große Resonanz beim<br />
Hambacher Fest 1832 mit insgesamt zwischen<br />
20.000 und 30.000 Teilnehmerinnen<br />
und Teilnehmern (ein Vielfaches der Wartburgfestbesucher<br />
also), begleitet von der<br />
Erhebung der Farben Schwarz-Rot-Gold zu<br />
den deutschen Nationalfarben, waren jedoch<br />
Lichtblicke für die Zukunft. Einige der<br />
Wartburgfestteilnehmer waren auch zum<br />
Hambacher Schloß gekommen, vor allem<br />
aber viele Vertreter der Liberalen der späteren<br />
Paulskirchenversammlung, unter ihnen<br />
Johann Adam von Itzstein, Karl von<br />
Rotteck und Karl Theodor Welcker, die<br />
schon Ende 1831 ein neues badisches Pressegesetz<br />
konzipiert hatten, das im Widerspruch<br />
zu den Karlsbader Beschlüssen<br />
stand. Welcker stellte mit einer 150-seitigen<br />
Petition an die Bundesversammlung in<br />
Frankfurt die Pressefreiheit als Naturrecht<br />
dar und meinte dazu: „Das beste Preßgesetz<br />
ist gar keines“.<br />
Am Frankfurter Wachensturm vom 3. April<br />
1833, einer sogenannten „Revolution vor<br />
<strong>Burschenschaftliche</strong><br />
<strong>Blätter</strong><br />
der Revolution“, waren Burschenschafter<br />
aus Frankfurt und Heidelberg sowie der<br />
näheren Umgebung beteiligt, aber auch<br />
spätere Paulskirchenabgeordnete wie Itzstein<br />
und der Marburger Professor und<br />
„Vater“ der Kurhessischen Verfassung Sylvester<br />
Jordan sowie vom Vorstand des<br />
Preß- und Vaterlandsvereins der Frankfurter<br />
Rechtsanwalt Gustav Peter Körner. Somit<br />
bestehen auch Querverbindungen von der<br />
Burschenschaft zur Paulskirchenversammlung.<br />
Der Wachensturm war unter anderem<br />
– politisch gesehen – ein Plädoyer für freie<br />
Presse und freie Rede und letztendlich gegen<br />
den in Frankfurt tagenden Bundestag<br />
(der Fürsten) gerichtet.<br />
In der Frankfurter Nationalversammlung<br />
saßen – von ihrem in der Heidelberger und<br />
Jenaischen Burschenschaft wurzelnden<br />
Präsidenten Heinrich von Gagern abgesehen<br />
– immerhin 169 Burschenschafter neben<br />
anderen Korporierten, darunter<br />
106–115 Alte Corpsstudenten, die zum<br />
Teil auch als Burschenschafter geführt wurden,<br />
unter den insgesamt etwa 585 Abgeordneten.<br />
Zu den Verdiensten dieser Nationalversammlung<br />
gehört die Verfassung<br />
des Deutschen Reiches vom 28. März 1849<br />
– nach Lothar Gall „die modernste Verfassung<br />
Europas, mit allgemeinem Wahlrecht,<br />
Judenemanzipation und Rechtsstaatlichkeit“<br />
unter Betonung der Grundrechte. Sie<br />
wurde mit knapper Mehrheit angenommen<br />
und bestand aus 197 Paragraphen. Zu den<br />
Von links: Preisträger Peter Wrabetz, 3. Nationalratspräsident Martin Graf und Preisträger die „Deutsche Burschenschaft“.<br />
Parlamentsdirektion/Bildagentur Zolles KG/Mike Ranz<br />
Heft 4 - <strong>2014</strong> 133