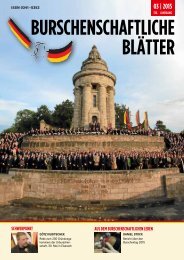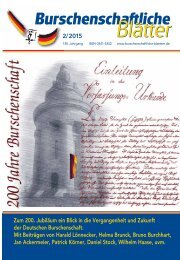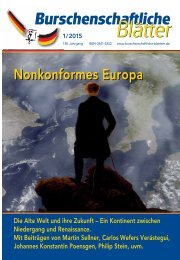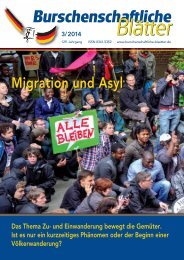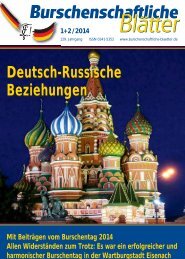Burschenschaftliche Blätter 2014 - 4
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Geschichte<br />
III. Die Revolution von 1848/49<br />
In Breslau wurde im März 1848, in den ersten<br />
Tagen der Revolution, eine angekündigte<br />
Aufführung des Rossinischen Tell<br />
durch Verfügung des schlesischen Oberpräsidenten<br />
Wilhelm Felix Heinrich Magnus v.<br />
Wedell verboten. Grund dafür war, daß es<br />
im Vorfeld öffentliche Auseinandersetzungen<br />
während einer Versammlung gegeben<br />
hatte. Darüber hinaus traute die Regierung<br />
der ungewöhnlichen Ruhe am Faschingsdienstag<br />
nicht. Die lapidare Meldung der<br />
«Frankfurter Oberpostamts-Zeitung» lautete:<br />
„Durch eine Verfügung vom hiesigen<br />
königl. Polizei-Präsidium ist die für heute angekündigte<br />
Aufführung der Oper ‚Wilhelm<br />
Tell’ untersagt worden.“ An diesem Tag<br />
verbreitete sich in Breslau „das Gerücht, der<br />
bekannte Volksmann Graf Reichenbach<br />
würde im Theater erscheinen und eine Demonstrationsrede<br />
an das Publikum halten.<br />
Die ‚gefährliche‘ Oper mußte auf Befehl der<br />
Polizei in letzter Stunde abgesetzt werden<br />
und da eine andere Vorstellung in der Eile<br />
nicht möglich war, so fiel sie ganz aus.“<br />
Am 24. März 1848 wurde die Oper dann<br />
aber doch aufgeführt: „An dem Abend dieses<br />
Tages war das Breslauer Theater der<br />
Schauplatz einer seltenen Feier und eines<br />
Volks-Enthusiasmus, wie wir ihn seit 1813 in<br />
Breslau nicht gesehen haben.“ Mit diesen<br />
Worten beginnt der Bericht des Breslauer<br />
Kaufmanns Karl Friedrich Hempel<br />
(1789–1851) über die Geschehnisse. Im<br />
Folgenden beruft er sich auf eine nicht<br />
näher definierte Schilderung:<br />
„Es schien“, sagt ein Berichterstatter, „nicht<br />
ein Theater-Publikum sich versammelt zu<br />
haben, nicht Menschen, die gleichgültig<br />
und zufällig nebeneinander sitzen und da<br />
gekommen sind, um einige Stunden durch<br />
Sinnenreiz zu tödten. Nein! eine<br />
einzige große Familie war es,<br />
die sich versammelt hatte, um<br />
ein heiliges, für alle Glieder<br />
gleichen Antheil bietendes Fest<br />
zu feiern; die morschen Schranken<br />
der verschiedenen Stände<br />
schienen gefallen und alle wollten<br />
nur für einen Zweck für ein<br />
edles Gefühl sich einen. Ein<br />
Volksfest war es, dessen Sinn<br />
man nicht allein in der freudigen<br />
Stimmung erkannte, sondern<br />
auch in allen Äußerlichkeiten,<br />
wie die glänzenden Toiletten<br />
der Damen, geschmückt<br />
mit Bändern deutscher und des<br />
Landes Farben, das schönste<br />
Zeugniß gaben.“<br />
Das Theater selbst war festlich<br />
decorirt und erleuchtet; in der<br />
Mitte, der Bühne gegenüber,<br />
entfaltete sich mächtig das<br />
Banner Deutschland in seiner<br />
dreifarbigen Pracht. Als der<br />
Vorhang sich erhob, war auf<br />
der Bühne das sämtliche<br />
Opern-Personal im altdeutschen Costum<br />
und welches Fahnen deutscher Farben<br />
trug, in einem Halbkreis aufgestellt. (sic!)<br />
Herr Heese, ein junger talentvoller Schauspieler,<br />
als Genius der jungen deutschen<br />
Freiheit, trat vor und sprach, eine dreifarbige<br />
Fahne in der Hand, schön und erhebend<br />
den hierauf sich beziehenden Prolog<br />
von Lasker. Nachdem dieser mit dem allgemeinsten<br />
Beifall aufgenommen worden,<br />
sang Herr Rieger den Festgesang „Ich bin<br />
ein Deutscher, kennt ihr meine Farben“,<br />
ebenfalls von unserem Landsmann Lasker<br />
gedichtet. Das Publikum, förmlich electrisirt,<br />
sang im vollen Chor den Refrain mit<br />
und verlangte stürmisch die Wiederholung,<br />
die dann auch, gleichen Enthusiasmus erzeugend,<br />
erfolgte. Hierauf begann die<br />
Oper „Wilhelm Tell“, die von unserem<br />
peinlichen, engherzigen Ober-Präsidenten<br />
noch vor wenigen Tagen aufs strengste verboten<br />
worden und deren flammensprühende<br />
Musik ganz für die heutige Stimmung<br />
geeignet war. Nach dem ersten Akt<br />
stimmte die Versammlung zum dritten Mal<br />
den Laskerschen Festgesang an und nach<br />
dem zweiten Akt verlangte es die Marseillaise<br />
und beruhigte sich nicht eher, bis das<br />
<strong>Burschenschaftliche</strong><br />
<strong>Blätter</strong><br />
Orchester nachgab und das französische<br />
Volkslied spielte. Letzteres wurde später<br />
von der gesamten Presse scharf getadelt.<br />
Aus anderen deutschen Städten sind keine<br />
derartigen Zwischenfälle überliefert. Das<br />
liegt nicht etwa daran, daß die Oper nicht<br />
gespielt wurde. Vielmehr gab es 1848 zahlreiche<br />
Aufführungen. In Frankfurt am Main<br />
etwa wurde die Oper am 30. März 1848 am<br />
Vorabend der Versammlungseröffnung in<br />
der Frankfurter Paulskirche im Stadttheater<br />
aufgeführt. Erst 1849 ging die Zahl der Aufführungen<br />
etwas zurück. Die Oper wurde<br />
aber zumindest an vier Hofopern gespielt.<br />
Aber auch außerhalb der Theater wurde<br />
Rossinis Musik 1848 für politische Zwecke<br />
eingesetzt, vermutlich weil seine Musik immer<br />
noch sehr populär war. Am 7. August<br />
1848 kam es im Orangeriehaus zu Bessungen<br />
bei Darmstadt zu einer „Großen musikalischen<br />
Aufführung zum Besten der deutschen<br />
Kriegsflotte“, zu dem der Melomanen-Verein<br />
einen Trinkchor – vermutlich aus<br />
Le Comte Ory – von Rossini beisteuerte.<br />
Damit wurde Rossinis beliebter, aber gänzlich<br />
unpolitischer Chor für eine eminent politische<br />
Sache vereinnahmt, handelte es<br />
sich doch um ein Benefizkonzert zugunsten<br />
der von der Frankfurter Nationalversammlung<br />
gewollten deutschen Kriegsmarine im<br />
Zusammenhang mit dem Schleswig-Holsteinischen<br />
Krieg (1848–1851).<br />
IV. Schluß<br />
Die wenigen, aber markanten Beispiele haben<br />
gezeigt, daß die Musik Rossinis und<br />
die Aufführungen seiner Opern durchaus<br />
geeignet waren, in revolutionären<br />
Zeiten als Brandbeschleuniger zu dienen.<br />
Das ist für die „gefährliche“ Oper „Wilhelm<br />
Tell“ leicht verständlich, „weil die Bezüge<br />
zur aktuellen politischen Situation so einfach<br />
hergestellt werden konnten“. Daß<br />
dazu aber nicht nur geeignete Stoffe und<br />
martialische Musikstücke dienten, verblüfft<br />
auf den ersten Blick, läßt sich aber aus dem<br />
spöttischen, ironischen Charakter leicht erklären.<br />
Auch wenn die Unruhen in Breslau<br />
nicht die Auswirkungen von Aubers La Muette<br />
de Portici hatten, die es immerhin zum<br />
Auslöser der belgischen Revolution<br />
brachte, so zeigt sich doch auch hier eindrücklich<br />
die gesellschaftliche und poli -<br />
tische Bedeutung von Musik im 19. Jahrhundert.<br />
Unser Autor Professor Dr. Bernd-Rüdiger Kern studierte Rechtswissenschaft<br />
an der Universität Heidelberg und war nach dem<br />
ersten juristischen Staatsexamen 1974 Assistent am Institut für<br />
Rechtsgeschichte an der Universität Berlin. Anschließende Tätigkeit<br />
als Referendar am Kammergericht Berlin und zweites Staatsexamen<br />
im Februar 1978. Danach Assistent bei Prof. Laufs in<br />
Heidelberg und Promotion im Jahre 1980 sowie Habilitation 1988<br />
in Tübingen. Von 1993 an Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches<br />
Recht, Rechtsgeschichte und Arztrecht der Universität Leipzig.<br />
Seit Oktober <strong>2014</strong> ist Professor Dr. Bernd-Rüdiger Kern emeritiert.<br />
Heft 4 - <strong>2014</strong> 147