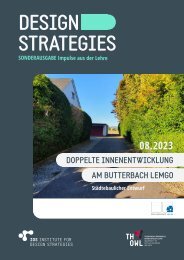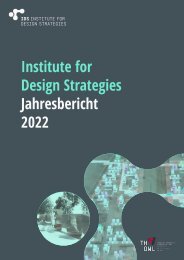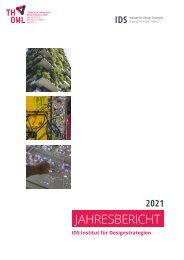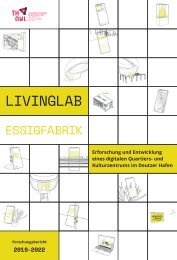urbanLab Magazin 2017 - Die Stadt der Zukunft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und Kin<strong>der</strong>betreuung erleichtert. Der Wohnbereich<br />
und das Wohnumfeld haben gerade für marginalisierte<br />
und arbeitslose Bevölkerungsgruppen eine<br />
so hohe Bedeutung im Lebensalltag, da sie den<br />
überwiegenden Teil ihrer Zeit hier verbringen. Aus<br />
zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, dass das<br />
informelle Beziehungsnetz zu Freunden, Verwandten<br />
und Nachbarn von hoher Wichtigkeit ist, da ein<br />
Großteil <strong>der</strong> Unterstützung im Alltag über diese<br />
Kontakte und nahräumlichen Netzwerke erfolgt.<br />
Schließlich ist gerade für benachteiligte Gruppen<br />
die Nähe von Beratungs- und Freizeiteinrichtungen<br />
relevant, um <strong>der</strong>en Nutzung zu ermöglichen und<br />
eine Inanspruchnahme zu för<strong>der</strong>n.<br />
Das Mitte <strong>der</strong> 1990er Jahre in Deutschland eingeführte<br />
Städtebauför<strong>der</strong>ungsprogramm „Soziale<br />
<strong>Stadt</strong>“ ist in diesem Zusammenhang als Antwort auf<br />
die Konzentration und Kumulation unterschiedlicher<br />
sozialer, ökonomischer und städtebaulicher Problemlagen<br />
in bestimmten <strong>Stadt</strong>teilen und Quartieren<br />
zu verstehen, die mit rein sektoralen Politikansätzen<br />
nicht mehr gelöst werden können. Damit folgte die<br />
Politik in Deutschland Erfahrungen mit ähnlichen<br />
Ansätzen in Großbritannien, den Nie<strong>der</strong>landen und<br />
Frankreich, die dort schon seit den 1980er Jahren<br />
praktiziert werden. Spätestens mit <strong>der</strong> Leipzig-Charta<br />
<strong>der</strong> EU im Jahre 2007 haben sich solche<br />
integrierten und stadtteilbezogenen Ansätze<br />
in ganz Europa etabliert. Sie folgen auch bewusst<br />
dem „ressourcenorientierten“ Politikverständnis, bei<br />
dem gerade die Stärkung von Nachbarschaften und<br />
Quartieren zur Lebensbewältigung von benachteiligten<br />
Bevölkerungsgruppen in den Mittelpunkt gerückt<br />
werden.<br />
Erfolge <strong>der</strong> „Sozialen <strong>Stadt</strong>“...<br />
Grundsätzlich zeigt sich, dass das Programm „Soziale<br />
<strong>Stadt</strong>“ mit seinem integrierten Handlungsansatz<br />
in hohem Maße den multiplen Problemlagen von<br />
benachteiligten <strong>Stadt</strong>teilen und Quartieren sowie<br />
den Herausfor<strong>der</strong>ungen einer zunehmenden sozialräumlichen<br />
Polarisierung in unseren Städten entspricht.<br />
Auch die verschiedenen Evaluationen des<br />
Programms „Soziale <strong>Stadt</strong>“ auf Ebene von Bund und<br />
Län<strong>der</strong>n bestätigen, dass dieser Ansatz im Rahmen<br />
seiner – auch finanziellen – Möglichkeiten richtig<br />
und erfolgreich ist (Zimmer-Hegmann/Sucato<br />
2007). Dabei zeigt sich, dass <strong>der</strong> bisherige Erfolg<br />
des Programms vor allem in <strong>der</strong> städtebaulichen Erneuerung<br />
und <strong>der</strong> Schaffung von tragfähigen Netzwerken<br />
vor Ort liegt. Durch eine Verbesserung des<br />
städtebaulichen Erscheinungsbildes sind in vielen<br />
<strong>Stadt</strong>teilen Aufwertungsprozesse in Gang gesetzt<br />
worden, die auch zu einer langfristigen Imageverbesserung<br />
<strong>der</strong> Gebiete führen können, die meist<br />
unter einer negativen Stigmatisierung leiden. Allerdings<br />
zeigen die gerade in den letzten Jahren zu beobachtenden<br />
Verän<strong>der</strong>ungen und Engpässe auf den<br />
Wohnungsmärkten insbeson<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Mehrzahl<br />
<strong>der</strong> Großstädte, dass solche Aufwertungsprozesse<br />
immer in ihrem jeweiligen stadtentwicklungspolitischen<br />
Kontext betrachtet werden müssen. Während<br />
nach wie vor in den schrumpfenden Städten gerade<br />
die benachteiligten <strong>Stadt</strong>teile und Quartiere von<br />
mangeln<strong>der</strong> Nachfrage und Abwan<strong>der</strong>ung betroffen<br />
sind, rückt in den angespannten Wohnungsmärkten<br />
das Thema „Gentrifizierung“ und damit letztlich die<br />
Gefahr <strong>der</strong> Verdrängung von sozial benachteiligten<br />
Bevölkerungsgruppen wie<strong>der</strong> auf die Tagesordnung.<br />
Städtebauliche Aufwertungsprozesse gerade<br />
durch das Programm „Soziale <strong>Stadt</strong>“ müssen daher<br />
immer in ihren spezifischen Wirkungszusammenhängen<br />
von Städten zwischen Schrumpfung und<br />
Wachstum betrachtet werden. So muss die städtebauliche<br />
Aufwertung in bestimmten angespannten<br />
Gebietskulissen nicht immer die erste und beste<br />
Antwort sein, wenn sozial stabilisierende Maßnahmen<br />
und Projekte im Sinne <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong><br />
angestammten Bewohnerschaft hier wesentlich<br />
wirksamer sein können, wozu aber insbeson<strong>der</strong>e<br />
auch Investitionen in die soziale Infrastruktur gehören.<br />
Deswegen muss das Programm mehr als ein<br />
städtebauliches Investitionsprogramm sein. Investitionen<br />
in Personal sind ebenso erfor<strong>der</strong>lich, aber<br />
über das städtebauliche Programm nur in begrenztem<br />
Umfang för<strong>der</strong>fähig. Ein integrierter Programmansatz<br />
müsste eine differenzierte Anwendung unterschiedlicher<br />
Instrumente ermöglichen.<br />
Zentrale Erfolgsfaktoren des Programms „Soziale<br />
<strong>Stadt</strong>“ sind daneben die Verfahrens- und Prozessqualitäten.<br />
<strong>Die</strong> Vernetzung aller relevanten Akteure<br />
in den Gebieten und die Schaffung bzw. Festigung<br />
von gemeinsamen Arbeits- und Kooperationsstrukturen<br />
sind zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige<br />
Stabilisierung <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong>teile und Quartiere.<br />
Insbeson<strong>der</strong>e die lokalen Quartiersmanagements<br />
haben sich als entscheidende steuernde und koordinierende<br />
Instanzen erwiesen. Allerdings ist auch<br />
auf die fragile Stabilität dieser neu geschaffenen<br />
Strukturen hinzuweisen, die oftmals auch nach Auslaufen<br />
<strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung durch das Programm „Soziale<br />
<strong>Stadt</strong>“ erfor<strong>der</strong>lich sind und weiterhin <strong>der</strong> Unterstützung<br />
bedürfen. <strong>Die</strong> neu geschaffenen Arbeits- und<br />
Kooperationsstrukturen haben in vielen Fällen zu<br />
einer deutlichen Verbesserung <strong>der</strong> Zusammenarbeit<br />
zwischen öffentlichen und privaten Akteuren<br />
sowie innerhalb <strong>der</strong> Verwaltungen geführt. Ob sich<br />
daraus dauerhaft Strukturen <strong>der</strong> integrierten Zusammenarbeit<br />
entwickeln, ist stark von den örtlichen<br />
politischen Gegebenheiten und <strong>der</strong> gelebten<br />
Verwaltungskultur abhängig. Allerdings zeigt sich,<br />
dass <strong>der</strong> integrierte Programmansatz strukturell<br />
die Kooperation unterschiedlicher Akteure – auch<br />
innerhalb <strong>der</strong> Verwaltung – immer wie<strong>der</strong> erzwingt<br />
und sich insofern deutlich för<strong>der</strong>nd auf solche kooperativen<br />
Arbeitsstrukturen auswirkt.<br />
... und Begrenzungen<br />
Im Grunde ist <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ansatz <strong>der</strong> „Sozialen <strong>Stadt</strong>“<br />
seinem Anspruch nach sozialraumbezogener Ausdruck<br />
einer präventiven Politik, <strong>der</strong> es darum geht<br />
41<br />
Soziale <strong>Stadt</strong> - KEYNOTE