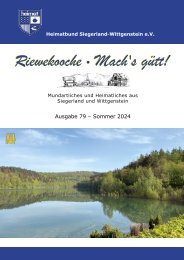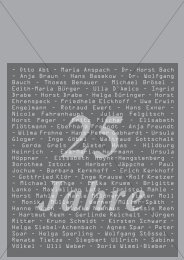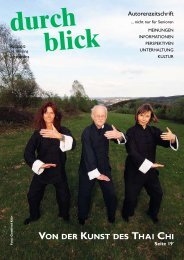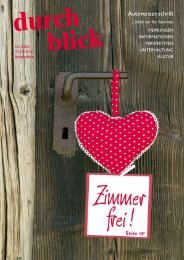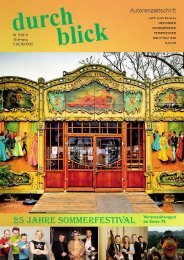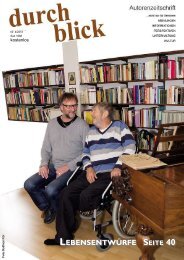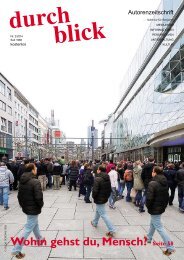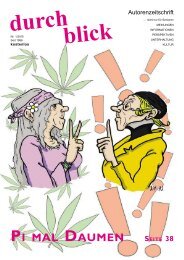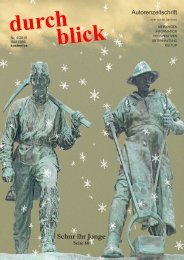db-WEB 1-2022
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zum Teufel mit dem Wetter<br />
Foto: Wikimedia Commons<br />
Es gibt viele Wetterregeln, trotzdem lässt sich kein<br />
Wetter regeln! (E. H. Bellermann). Sieht man mal<br />
von der modernen Floskel wie geht es ab, mit der<br />
Mensch im fortgeschrittenen Alter gleich beim Thema<br />
Krankheiten ist, sind Äußerungen zum Wetter wohl ein<br />
ebenso häufig genutzter, nicht seltener Einstieg in zwanglose<br />
Gespräche. Dass das Wetter nicht immer allen gefällt,<br />
ist keine neue Weisheit. Dem Sommerfrischler ist es zu<br />
heiß, dem Landwirt ist es zu trocken, freuen sich Naturliebhaber<br />
über den Regen, ist es dem Wanderer vielleicht<br />
viel zu feucht. Dem Stubenhocker ist es zu kalt, den Wintersportler<br />
nicht kalt genug (usw.). Also: Auf die Einstellung<br />
kommt es an; wie sagte doch schon Wilhelm Busch:<br />
„Dauerhaftem schlechtem Wetter<br />
mußt du mit Geduld begegnen,<br />
mach es wie die Schöppenstedter:<br />
regnet es, so laß es regnen.“<br />
Und John Ruskin findet. Sonnenschein ist köstlich,<br />
Regen erfrischend, Wind fordert heraus, Schnee macht<br />
fröhlich; im Grunde gibt es kein schlechtes Wetter nur<br />
verschiedene Arten von gutem Wetter“ (Wikipedia). Und<br />
doch bestätigt sich das Sprichwort eines unbekannten Verfassers.<br />
Ob Sonnenschein, ob Regen, wir sind dagegen.<br />
Wobei wir bei E. Ellinger sind, der feststellt: Der Teufel<br />
soll sie holen, die Wetterkapriolen. Doch was hat der Teufel<br />
damit zu tun?<br />
Dass schlechtes Wetter eine Teufelsangelegenheit ist,<br />
gehörte zum festen Glauben der Menschen im Mittelalter.<br />
Als der HERR die Geduld mit seinen Geschöpfen verlor,<br />
beschloss er, sie zu ersäufen! `Alles was auff Erden ist sol<br />
untergehen`, so drückte Luther es in seiner Übersetzung<br />
des 1. Buch Mose aus. Wasser und Wetter bringen Not über<br />
die Menschen, seit Kain ein Ackermann geworden ist und<br />
seinen Bruder, den Hirten Abel, erschlagen hat, schreibt<br />
Bruno Preisendörfer. 1<br />
In der Lutherzeit, also zu Beginn des 16. Jahrhunderts,<br />
so berichtet er weiter, stand den Bauern in vielen Jahren<br />
das Wasser bis zum Hals, in anderen Jahren wiederum<br />
verdorrte ihnen die Frucht am Halm, und die Erde zeigte<br />
Risse vor Trockenheit.<br />
Im März 1510 2 herrschten Frost, Schnee und Regen,<br />
dass kaum Sommerfrüchte gewachsen sind und eine große<br />
Teuerung einsetzte. 1514 konnten in vielen deutschen Gegenden<br />
die Mühlen wegen der Vereisung der Flüsse und<br />
im Sommer desselben Jahres wegen ihrer Austrocknung<br />
nicht arbeiten. Im März und April 1517, also im Frühling,<br />
herrschten nach einem strengen Winter in Süd- und Westdeutschland<br />
nahezu sommerliche Temperaturen, Klimaforscher<br />
sprachen von einem der trockensten Monate des Jahrhunderts.<br />
Im Hochsommer des gleichen Jahres wiederum<br />
brachen langandauernde Regenfälle über das ausgedörrte<br />
Land herein, bis im September eine neue Trockenheit einsetzte.<br />
1521 gab es den wärmsten Winter des Jahrhunderts.<br />
Im Februar haben die Kirschen geblüht. Und Ostern war<br />
es kälter als zu Weihnachten und es schneite mehr als im<br />
ganzen Winter. Und im folgenden Jahr war der Winter dagegen<br />
kalt und trocken, der Main fror von Mitte Januar bis<br />
Anfang März zu, im Februar rührte sich der Vater Rhein<br />
bei Köln vor Frost nicht mehr von der Stelle. 1524 hagelte<br />
es bei Schaffhausen so stark, dass Eiskörner, Hühnerei<br />
groß, Korn und Wein vernichtet und Häuser und Fenster<br />
zerschlagen haben. Im folgenden Jahr 1525 lag morgens<br />
Schnee um die Festung Marienberg über Würzburg. Mitte<br />
September 1527 fiel in fränkischen und österreichischen<br />
Gebieten wegen starken Frosteinbruchs die Ernte aus. Im<br />
Sommer des Jahres 1529 war es in ganz Mitteleuropa nass<br />
und kalt, überall traten die Flüsse über die Ufer. Fünf Jahre<br />
später, im Jahr 1534 folgte auf einen kalten Winter, in dem<br />
die Flüsse zufroren, ein extrem heißer Sommer, der z.B.<br />
die Oder in ein Rinnsal verwandelte. Auch 1538 beklagte<br />
man in Wittenberg über eine extreme Dürre. Aus der Reihe<br />
dieser auffälligen Wetterereignisse sticht das Jahr 1540 auf<br />
dramatische Weise hervor. Der Rhein wurde an manchen<br />
Stellen so seicht, dass man ihn durchwaten konnte. Die<br />
Weiden trockneten aus und das Vieh verendete, schreibt<br />
Preisendörfer.<br />
Verhextes Wetter<br />
Für die außergewöhnliche Trockenheit oder Regenzeit<br />
suchten die Menschen seinerzeit – wie schon bei der Pest<br />
– nach einer Erklärung. Die einen sahen darin eine Strafe<br />
Gottes, anderen kam es eher wie Teufelswerk vor. Für<br />
Letzteres musste jemand verantwortlich sein, der mit dem<br />
Teufel buhlt. Die Richter des Amtes Augustusburg/Schellberg<br />
schickten im Jahre 1529 eine ältere Frau wegen Wetterzaubers<br />
auf den Scheiterhaufen. Dass jemand mit dem<br />
Teufel im Bunde steht, glaubte auch der Landvogt von<br />
Wittenberg, ging auf Suche und wurde fündig. Er ließ im<br />
Dürrejahr 1540 die Herumtreiberin, in Wirklichkeit eine<br />
wehr- und schutzlose Außenseiterin, mit Namen Prista<br />
Frühbottin verhaften. Man warf ihr vor, Vieh vergiftet und<br />
Wetter gemacht zu haben und schickte sie zur Hölle, in<br />
dem sie am Pfahl geröstet (also als Hexe verbrannt) wurde.<br />
Dem damaligen Wissensstand und Zeitgeist entsprechend<br />
war für außergewöhnliche Ereignisse oft schnell<br />
eine Lösung gefunden: Schuld waren Hexen (nicht nur<br />
Frauen, auch Männern wurde Hexerei vorgeworfen; und<br />
manchmal wurden Menschen als Hexen verurteilt, weil sie<br />
gute Erblasser waren).<br />
Den Hexen war alles zuzutrauen. Dem Hexenglauben<br />
unterlagen in jener Zeit nicht nur Grafen und Fürsten<br />
sowie Fürstbischöfe und andere bedeutende Persönlichkeiten;<br />
selbst Martin Luther glaubte an Hexen und<br />
Teufel und die protestantische Konkurrenz am Genfer<br />
See (Calvin) blies heftig ins Feuer, ist bei Preisendörfer<br />
zu lesen.<br />
Dass man die Frühbottin zu Unrecht verbrannt hatte,<br />
zeigte sich in den Folgejahren. Trotz ihres Todesopfers<br />
folgten in den Jahren 1572 bis 1573 Dürre und Hungersnot<br />
und vier Jahre später setzte im Sommer Hochwasser ein,<br />
so dass Menschen und Tiere zu Tode kamen.<br />
Schon im Jahre 1571 wurde in Schlesien über Steuererleichterung<br />
beraten, weil diß Land mit „großen Mißwachs/<br />
Wassernöthen und anderen Beschwerungen/Hunger/Armut/Absterbung<br />
der Schaff/Rindt und allerlei Viehes beladen<br />
und dem Lande auch alle Nahrung und Gewerb enfellet,<br />
schreibt Conrads. 3<br />
Im Jahre 1587 mussten in Schlesien die Schnitter bei<br />
der Ernte Pelze anziehen, so dass die kommenden Jahre<br />
Notzeiten wurden. Kürzere Sommer und übermäßige Nässe<br />
beeinträchtigten die Ernteerfolge doppelt. Besonders<br />
hart waren auch die Jahre 1602/1603 und 1607/1608. 2 So<br />
war es die Jahrhunderte hindurch.<br />
Der ungerechtfertigte Tod der Frühbottin hat aber wohl<br />
keinen mehr gerührt. Geschehen ist geschehen!<br />
<br />
58 durchblick 1/<strong>2022</strong>