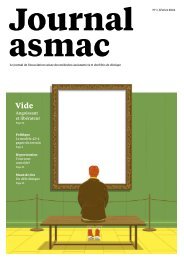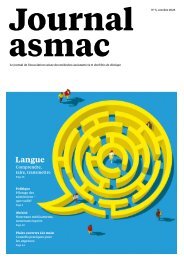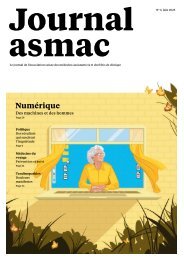vsao Journal Nr. 3 - Juni 2023
Digital - Von Maschinen und Menschen Politik - Die Umfrage zeigt Bedenkliches Reisemedizin - Vor- und Nachsorge Tendinopathien - «Handfeste» Schmerzen
Digital - Von Maschinen und Menschen
Politik - Die Umfrage zeigt Bedenkliches
Reisemedizin - Vor- und Nachsorge
Tendinopathien - «Handfeste» Schmerzen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fokus: Digital<br />
Die FMH veröffentlichte im<br />
Herbst 2022 eine ausführliche<br />
Publikation über die Einsatzgebiete<br />
künstlicher Intelligenz<br />
im ärztlichen Arbeitsalltag und<br />
benannte dabei auch ethische Herausforderungen.<br />
Offensichtlich haben neue<br />
innovative Softwareprogramme damit<br />
begonnen, die klinische Patientenversorgung<br />
und die ärztliche Arbeitswelt in<br />
Spitälern zu verändern. Diese Entwicklung<br />
bringt neue Aspekte mit sich, die es<br />
den Behandelnden erschweren werden,<br />
die umfassend richtigen, weil fachlich<br />
besten, und ethisch primär am Patientenwohl<br />
ausgerichteten Entscheidungen zu<br />
treffen.<br />
Ärztliches Handeln bedeutet immer,<br />
Entscheidungen unter (Rest-)Unsicherheit<br />
treffen zu müssen. Damit verbunden<br />
ist die Verantwortung für die Konsequenzen<br />
und die Hoffnung, den bestmöglichen<br />
medizinischen Outcome für die sich anvertrauenden<br />
Patienten zu erzielen. Ärztliches<br />
Fachwissen und berufliche Expertise,<br />
ergänzt um die kollegiale Mentorenschaft<br />
durch erfahrene Ärztinnen und Ärzte, ermöglichen<br />
es von jeher, die mit den Behandlungsentscheidungen<br />
verbundenen<br />
Behandlungsrisiken bestmöglich zu berücksichtigen.<br />
Ärztliches Handeln ist somit<br />
immer auch das stetige Bemühen, Unsicherheiten<br />
in therapeutische Gewissheit<br />
zu transformieren.<br />
Keine Chance ohne Risiken<br />
Algorithmenbasierte Softwareprodukte<br />
scheinen ihren klinischen Benutzern eine<br />
attraktive Option anzubieten, das persönliche<br />
Handeln in der Patientenver sorgung<br />
zu optimieren. Insbesondere die klinische<br />
Dokumentation, klinische Entscheidungsunterstützungssysteme<br />
und das Patientenmonitoring<br />
zur Überwachung des Therapiefortschritts<br />
und der Therapieadhärenz<br />
können eine hilfreiche Unterstützung<br />
sein. So administrativ aufwendig das<br />
Füt tern dieser Digitaltools mit relevanten<br />
Informationen sein mag, so verlockend<br />
erscheint die neue Perspektive, die eigene<br />
ärztliche Entscheidung nun besser<br />
fachlich vorbereiten und begründen zu<br />
können.<br />
Der Einbezug digital berechneter Wirkungs-<br />
und Erfolgswahrscheinlichkeiten<br />
in die ärztlichen Versorgungsentscheidungen<br />
erweitert bisherige Versorgungsmöglichkeiten<br />
um eine digitaltechnologisch<br />
erzeugte Datenrationalität. Bei Misserfolg<br />
sinken aber auch die Chancen für<br />
die Ärzteschaft, spätere Kritik an ihren<br />
Therapieentscheidungen und auch persönliche<br />
Haftungsrisiken abwehren zu<br />
können; spätestens dann, wenn der Technologieeinsatz<br />
seinen ausdrücklichen Eingang<br />
in die allgemein anerkannten medizinisch-wissenschaftlichen<br />
Versorgungsstandards<br />
gefunden hat. Wie steht es dann<br />
um die berufsethische Verpflichtung der<br />
Ärzteschaft, das Wohl der Patientinnen<br />
und Patienten stets in den Mittelpunkt der<br />
Versorgungsüberlegungen zu stellen?<br />
Moral Distress als Nebenwirkung<br />
Der Einbezug entscheidungsunterstützender,<br />
wenn nicht sogar entscheidungserleichternder<br />
KI-gestützter Softwaretools<br />
am klinischen Arbeitsplatz könnte für<br />
Behandelnde zukünftig moralisch herausfordernde<br />
Situationen mit sich bringen.<br />
Eine Grundbedingung sinnhafter Berufsausübung<br />
für medizinisches Personal ist<br />
die persönliche Gewissheit, dass das eigene<br />
berufliche Handeln nicht im zermürbenden<br />
Konflikt mit den eigenen berufsethischen<br />
und versorgungsethischen<br />
Werten und moralischen Überzeugungen<br />
steht. Die anhaltenden Diskussionen in<br />
Bezug auf Ökonomisierungs-, Kommerzialisierungs-<br />
und Kommodifizierungstrends<br />
in der Patientenversorgung weisen<br />
auf die Bedeutung von Sinnhaftigkeitsfragen<br />
und Purpose-Themen insbesondere<br />
auch für den ärztlichen Berufsnachwuchs<br />
hin. Moral Distress führt zu erheblichen<br />
emotionalen Belastungen bei den Betroffenen.<br />
Diese empfinden ihr Handeln nicht<br />
nur als im Widerspruch mit ihren persönlichen<br />
Überzeugungen stehend, auch das<br />
Auseinanderfallen von eigenem moralischem<br />
Wollen und dem ihnen abverlangten<br />
tatsächlichen beruflichen Tun wird als<br />
ausweglos mit nur geringer Hoffnung auf<br />
Lösbarkeit gesehen. Niemand lebt gerne<br />
in dauerhafter Inkongruenz zwischen moralischem<br />
Wollen und klinikalltäglichem<br />
Müssen.<br />
In einer zunehmend digitaltechnologisch<br />
eingerahmten Spitalwelt entfaltet<br />
ein technizistisches Narrativ seine Wirkung,<br />
nämlich dass intelligente Software<br />
eine auf das Patientenwohl ausgerichtete<br />
Behandlung stets effizient und ressourcenschonend<br />
unterstützt. Die Urteilskraft<br />
des Arztes und der Ärztin reicht vielleicht<br />
aber nicht mehr dafür aus, die Qualität der<br />
durch komplexe Algorithmen berechneten<br />
Wahrscheinlichkeiten bei Diagnosen, Therapieempfehlungen<br />
und Gesundungsprädiktionen<br />
ausreichend umfänglich zu beurteilen.<br />
Das Vertrauen der Ärzte in die<br />
Richtigkeit häufig schwer erklärbarer Berechnungsergebnisse<br />
der eingesetzten Kliniksoftware<br />
wird zum hilflosen Ausweg,<br />
um dem Vertrauen der Kranken in die Behandelnden<br />
gerecht werden zu können.<br />
Nicht ohne Grund betrachten die industriellen<br />
Softwareanbieter das menschliche<br />
Vertrauen in ihre neuen Technologien als<br />
wichtigste Akzeptanzbedingung für ihre<br />
kommerzielle Verwertung.<br />
So wenig ein Mensch allein die Summe<br />
seiner mathematisch-digital abgebildeten<br />
biologischen Strukturen und Prozesse<br />
ist (auch wenn Digital-Twins-Konzepte<br />
als quasi digital-descartessche Menschensynthese<br />
es als machbar erscheinen lassen<br />
wollen), so wenig sind Ärztinnen und<br />
Ärzte am erkrankten Menschen eingesetzte<br />
Fachingenieure. Viele Ergebnisse<br />
wissenschaftlicher Evaluationen von im<br />
Gesundheitssektor eingesetzter KI-Software<br />
zeigen auf, dass die ärztliche Urteilskraft<br />
als bedeutendes Element ärztlicher<br />
Heilkunst mehr denn je gefordert ist, um<br />
die Möglichkeiten und die Grenzen dieser<br />
neuen Arbeitsinstrumente kritisch zu<br />
hinterfragen. Die Einschränkung ihrer<br />
Urteilskraft ist für die Betroffenen häufig<br />
eine belastende Begrenzung ihrer individuellen<br />
Handlungsoptionen und ihrer beruflichen<br />
wie persönlichen Autonomie.<br />
Eine durch klinische KI-Programme<br />
eingegrenzte ärztliche Urteilskraft kann<br />
im Versorgungsalltag nicht nur Schaden<br />
für Patienten mit sich bringen, sondern bei<br />
den betroffenen Ärzten auch das destruktive<br />
Gefühl des eigenen Nicht-(mehr-)Genügens<br />
und erhebliche Selbstzweifel erzeugen.<br />
Die berufliche Unmöglichkeit, alles<br />
umfassend wissen zu können und gleichzeitig<br />
die Erwartung des Wissen-Müssens<br />
auszuhalten, wird zur moralischen Herausforderung.<br />
Die Situation, den eigenen<br />
Ansprüchen vielleicht nicht mehr genügen<br />
zu können, aber trotzdem weiterzumachen<br />
(oder weitermachen zu müssen),<br />
ist ein guter Nährboden für ungesunden<br />
und leistungsschädlichen Moral Distress<br />
bei Ärztinnen und Ärzten. Auch könnten<br />
zukünftig verstärkt psychologische Phänomene<br />
wie das Imposter-Syndrom auftreten.<br />
Verstärkte Ökonomisierung durch<br />
digitale Industrialisierung?<br />
Klinisch tätige Ärzte sind nicht nur Anwender<br />
neuer Technologien in der Patientenversorgung,<br />
sondern mindestens mittelbar<br />
auch Produktentwickler. Die durch<br />
die Behandlungen entstehenden neuen<br />
Datenmengen werden vielfach zur Weiterentwicklung<br />
der eingesetzten Software<br />
<strong>vsao</strong> /asmac <strong>Journal</strong> 3/23 47