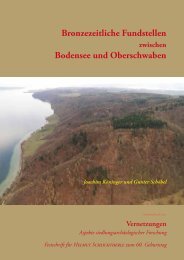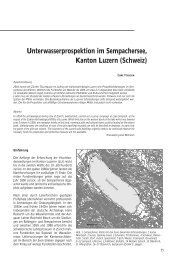Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
verzeichnet. Als ursächlich dafür werden jungneolithische<br />
Siedlungstätigkeiten mit einhergehenden Rodungen in der<br />
weiteren Umgebung und im direkten Umfeld der Station<br />
Allensbach-Strandbad angesehen, deren Niederschlag mit<br />
Schicht A in Verbindung gebracht werden könnte. Die Zonen<br />
3 bis 5 werden ins 39.–36. Jahrhundert v. Chr. gesetzt.<br />
Zwischen den Pollenzonen 5 und 6 stellt Rösch einen weiteren<br />
Hiatus von ca. 500 Jahren fest. Die Pollenzone AsPZ<br />
6, in der zwei durch einen Hiatus getrennte Kulturzeigerzonen<br />
erfasst sind, ist durch eine überproportionale Zunahme<br />
von Birke und Nichtbaumpollen gekennzeichnet. Die Zunahme<br />
der Birkenpollen könnte hier mit einer Verwendung<br />
von Birkenreisig zum Herstellen von Flechtwänden erklärt<br />
werden (Rösch 1990a, 101).<br />
Zwischen beiden Kulturzeigerzonen wird ein Hiatus von<br />
ca. 200 Jahren angenommen. Demnach wären in der Kulturschicht<br />
B, in deren Bereich AsPZ 6 liegt, zwei voneinander<br />
abgesetzte endneolithische Siedlungsphasen erfasst, die<br />
in das 32.–30. Jh. v. Chr. datieren.<br />
Die nachfolgende Pollenzone 7 weist einen Rückgang der<br />
Nichtbaumpollen- und Kulturzeigerwerte (Getreide) bei<br />
steigenden Baumpollenwerten auf. Dies spricht für eine Regenerierung<br />
der Wälder. Ohne weitere Schichtlücke folgen<br />
die Zonen AsPZ 8–10. Die erneut steigenden Nichtbaumpollen<br />
bei sinkenden Gehölzpollen werden mit einer zunehmenden<br />
Kultivierung der Waldlandschaft in Verbindung<br />
gebracht, wobei Kulturzeiger in den Zonen AsPZ 9 auf eine<br />
in der Nähe liegende Siedlung hinweisen. AsPZ 10 schließlich<br />
entspricht der Kulturschicht C. Die palynologisch ermittelten<br />
Altersangaben für AsPZ 8–10 liegen im Bereich<br />
des 29. und 28. Jhs. v. Chr. Nach einem weiteren Hiatus<br />
bildet die Pollenzone AsPZ 11 den Abschluss der Stratigraphie.<br />
Sie entspricht der obersten Seekreidelage (Bef. 2/3)<br />
und dokumentiert nach den Untersuchungsergebnissen einen<br />
Wasserhochstand während des Frühmittelalters.<br />
6.3.3 Großrestanalysen<br />
Im Rahmen einer Magisterarbeit an der Universität Tübingen<br />
führte Sabine Karg archäobotanische Untersuchungen<br />
an Probenmaterial aus Allensbach-Strandbad durch (Karg<br />
1990). Bearbeitet wurden die bereits erwähnten Profilsäulen<br />
E2 und E3 sowie ein schichtweise verprobtes Viertelquadrat<br />
aus dem Nordprofil von Sn 34. Durch die systematische<br />
Auswertung der Großrestproben aus den Sedimentprofilen<br />
sollten Informationen zur Siedlungslage und<br />
zur Wirtschaftsform der neolithischen Siedlungen gewonnen<br />
werden. Die folgende Zusammenfassung bezieht sich<br />
vorwiegend auf diejenigen Resultate, die aus botanischer<br />
Perspektive zur Beurteilung der Schichtenbildung beitragen.<br />
Das Spektrum der nachgewiesenen Pflanzenreste, ihre<br />
anteilige Verteilung in den Schichten und ihre stratigraphische<br />
Lage können Hinweise auf den Ablagerungsort der<br />
Sedimente und damit zum Seepegel während der Ablagerung<br />
geben.<br />
Die Seekreide an der Basis (Schichten 12–14) des Profils<br />
von Allensbach-Strandbad enthält zum größten Teil Wasserpflanzenreste.<br />
Demzufolge lässt sich eine Schichtbildung<br />
im sublitoralen Milieu mit ganzjähriger Wasserbedeckung<br />
ableiten. In den Schichten 13ab und 14a/b sind zusätzlich<br />
Holzkohle und Kulturpflanzenreste eingeschwemmt. Sie<br />
könnten mit den von M. Rösch festgestellten jungneolithischen<br />
Kulturzeigerzonen AsPZ 3 und AsPZ 4a zusammenfallen.<br />
Die Wasserpflanzenanteile nehmen an der Basis von Schicht<br />
B zugunsten von Pionierpflanzen, die schlammige und periodisch<br />
überschwemmte Böden bevorzugen, ab. Für den<br />
Zeitpunkt der ersten Besiedlung vor Ort wird daher eine<br />
jahreszeitlich überflutete Uferbank angenommen. Da die<br />
Wasserpflanzen in der gesamten Kulturschicht nachzuweisen<br />
sind, liegt eine Besiedlung im seewärtigen Eulitoral,<br />
d.h. im ständigen Einflussbereich des Wassers, nahe. Zur<br />
Oberkante der Kulturschicht hin ist ein erneutes Ansteigen<br />
der Wasserpflanzenanteile zu beobachten.<br />
In der folgenden Seekreidesequenz (Schicht 7) dominieren<br />
Wasserpflanzen, so dass mit einem Anstieg des Wasserpegels<br />
gerechnet wird. Der Anteil der Wasserpflanzen geht in<br />
den Schichten 7a und 6 wieder zurück, und Schicht C bildet<br />
sich in vergleichbar teilüberflutetem Milieu wie Schicht<br />
B. Auch an der Oberkante von Schicht C stellt Karg eine<br />
erneute Zunahme von Wasserpflanzenresten fest. Dies lässt<br />
die Bearbeiterin vermuten, dass die Siedlungen wegen gestiegenem<br />
Wasserpegel verlassen oder verlagert wurden.<br />
Das Vorkommen von Wald-, Grünland-, Acker- und Kulturpflanzen<br />
beschränkt sich hauptsächlich auf Kulturschichten<br />
und angrenzende Seekreiden. Eine große Bedeutung<br />
kommt den häufig belegten Ölsaaten Lein und Mohn<br />
zu. An Getreidearten sind Gerste, Nacktweizen, Emmer<br />
und vereinzelt Einkorn nachgewiesen. In Schicht C fanden<br />
sich verkohlte Erbsen, zudem weist hier eine Zunahme der<br />
Winterfruchtunkräuter auf ganzjährigen Anbau hin. Als<br />
Ackerflächen dürften beschattete Rodungsinseln im nahen<br />
Umkreis der Siedlungen gedient haben. Die Sammelpflanzen<br />
stammen zumeist aus anthropogen entstandenen<br />
Waldstandorten.<br />
6.3.4 Untersuchungen zur Wirbellosenfauna<br />
Die Siebrückstände der Großrestanalyse aus Profilsäule E3<br />
und der separat beprobte Molluskenhorizont unter Kulturschicht<br />
C (Bef. 6) wurde durch Edith Schmidt (1990)<br />
auf subfossile Wirbellosenreste untersucht. Ziel war es, „ergänzende<br />
Informationen zur Beschreibung der Lebensräume<br />
und Ablagerungsbedingungen“ zu erhalten (Schmidt<br />
1990, 173).<br />
Die Proben wurden insbesondere auf die Artenzahl der<br />
Mollusken, die sämtlich auch rezent am Bodensee vorkommen<br />
(Schmidt 1990, 176), deren Individuenzahl und den<br />
anteiligen Gehalt an Lungenschnecken untersucht. In keiner<br />
der Schichten aus der Profilsäule fanden sich landlebende<br />
Schnecken oder Insekten. Hauptsächlich vertreten sind<br />
Süßwasserschnecken, die sich in Lungenschnecken und<br />
Kiemenschnecken differenzieren lassen. Lungenschnecken<br />
halten sich in Bereichen mit geringer Wasserbedeckung auf,<br />
da sie zum Atmen über vertikale Elemente (Pflanze, Stein,<br />
Pfahl) an die Wasseroberfläche gelangen müssen. Kiemenschnecken<br />
kommen in allen Tiefen des Sublitorals vor.<br />
Da landlebende Arten fehlen, ist anzunehmen, dass die<br />
33