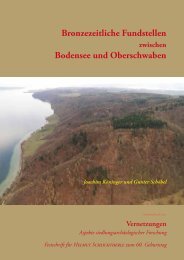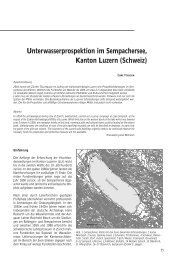Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ein fragliches Löffelfragment (Taf. 15B,164). Eine holzanatomische<br />
Bestimmung der beiden Fundstücke liegt nicht<br />
vor.<br />
6.10 Textilien<br />
Die insgesamt sechs Textilfunde aus Allensbach-Strandbad<br />
sind den Kategorien Seil, Geflecht und Gewebe zuzuordnen<br />
(zur Nomenklatur vgl. Rast-Eicher 1997; Körber-Grohne/Feldtkeller<br />
1998). Mit den beiden gut erhaltenen<br />
„Sandalen“ aus Bastgeflecht befinden sich zwei außergewöhnlich<br />
seltene und interessante Fundstücke darunter.<br />
Die Allensbacher Sandalenfunde (Taf. 16,165; 17,170) und<br />
ein weiteres Gewebefragment (Taf. 17,169) wurden bereits<br />
ausführlich vorgelegt (Feldtkeller/Schlichtherle 1987;<br />
Czarnowski 1988; Körber-Grohne/Feldtkeller 1998),<br />
worauf im Folgenden Bezug genommen wird.<br />
6.10.1 Gedrehte Fasern<br />
An gedrehten Fasern, worunter Faden, Schnur oder Seil zu<br />
verstehen sind, ist ein Stück eines unverkohlten Seiles aus<br />
Schicht B zu nennen (Taf. 16,165). Als Rohmaterial wurden<br />
Bastfasern verwendet. Das Seil ist aus doppelten, gedrillten<br />
Strängen gefertigt. Seine Stärke beträgt 1,3 cm. Ein 2,2 cm<br />
breiter Knoten darin wurde nicht näher untersucht.<br />
6.10.2 Geflechte<br />
Aus Schicht B stammt einer der seltenen prähistorischen<br />
Schuhfunde (Taf. 16,166; Abb. 56). Die Sandale ist 24,5<br />
cm lang und 12,5 cm breit, unverkohlt und fast vollständig<br />
erhalten. „Sandale 2“ wurde aus ungedrehten Lindenbaststreifen<br />
leinwandbindig geflochten. Sohle und Seitenteile<br />
wurden gebildet, indem das Geflecht vorne und zur Seite<br />
hochgezogen wurde. Die Ferse blieb offen, die Sohle wurde<br />
möglicherweise mit dünnen Lindenstäbchen verstärkt.<br />
Aus Schicht C wurde eine weitere Sandale geborgen (Taf.<br />
17,170; 18). „Sandalle 1“ war fragmentiert und ebenfalls<br />
unverkohlt erhalten. Sie ist 26 cm lang und 13 cm breit<br />
und in Leinwandbindung hergestellt. Als Rohmaterial wurde<br />
ungedrehter Gehölzbast vom Linden-Eichenbast-Typus<br />
verwendet. Ihre solide Machart zeigt sich in einem der Sohle<br />
aufgesetzten Rahmen.<br />
Weitere Schuhfunde aus der Horgener Kultur liegen aus<br />
Sipplingen Schicht 15, Wallhausen-Ziegelhütte (freundl.<br />
Mitt. C. Lübke) und Feldmeilen-Vorderfeld vor. Bei dem<br />
Fund aus Feldmeilen-Vorderfeld handelt es sich um das<br />
verkohlte Absatzfragment einer geflochtenen Sandale. Der<br />
Sipplinger Schuh ähnelt mit leinwandbindig geflochtenen<br />
Lindenbastfasern und seitlich hochgezogenem Geflecht<br />
den Allensbacher Bastschuhen. Er ist wie ‘Sandale 1’ aus<br />
Allensbach dem späten Horgen zuzuordnen. Ebenfalls horgenzeitlich<br />
ist das Schuhwerk des „Gletschermannes“, das<br />
mit Fellsohle, einem daran befestigten Schnurnetz, einem<br />
Oberleder und in die Schuhe gestopftem Gras den alpinen<br />
Verhältnissen angepasst war (Egg/Spindler 1992, 70 f.;<br />
Abb. 56: Schicht B. „Sandale 2“ aus Lindenbast (Foto LAD).<br />
100 ff.). Darüber hinaus dürften nur wenige neolithische<br />
Schuhfunde belegt sein. J. Winiger (1995, 138) verweist<br />
auf geflochtene neolithische Sandalen aus St. Blaise „Baindes-Dames“<br />
am Neuenburger See. A. Feldtkeller und H.<br />
Schlichtherle (1987, 82) machen auf eine Sandale mit<br />
Zehenlasche aus neolithischen Grabfunden bei Albuñol<br />
(Granada) und Schuhimitate aus Kalkstein aus dem endneolithischen<br />
Felskammergrab von Alapraia (Portugal) aufmerksam.<br />
Aus dem Fundmaterial von Allensbach liegen überdies zwei<br />
etwa 9–11 cm² große Konzentrationen von bündelweise<br />
gleichsinnig ausgerichteten Fasern vor (Kat.-Nr. 167), deren<br />
präzise Klassifizierung ohne detaillierte technische Untersuchungen<br />
jedoch vorderhand nicht möglich ist.<br />
Zu den Sonderformen unter den Geflechten zählen die Rindenschachteln,<br />
die aus breiten Rindenbahnen zusammengenäht<br />
wurden. Bei dem verkohlten Allensbacher Fragment<br />
ist der Rindenboden mit einer aufgesetzten Rindenbahn<br />
verbunden (Kat.-Nr. 168). Vermutlich wurde zur Stabilisierung<br />
ein dünnes Ästchen am äußeren Rand eingenäht.<br />
Das Allensbacher Stück gehört mit 14 cm Durchmesser zu<br />
den kleineren Exemplaren unter den Rindenschachteln, die<br />
bis zu einer Größe von ca. 40 cm Durchmesser belegt sind<br />
(Rast-Eicher 1997, 303; 310).<br />
6.10.3 Gewebe<br />
Bei dem einzigen Gewebefund aus Allensbach handelt<br />
es sich um ein in Schicht C stratifiziertes, verkohltes und<br />
3,3 x 4 cm großes Eckfragment aus Flachs (Taf. 17,169).<br />
Wie alle bisher aus den neolithischen Seeufersiedlungen<br />
Südwestdeutschlands bekannten Gewebe (Feldtkeller/<br />
Schlichtherle 1987, 25), ist es in leinwandbindiger Form<br />
hergestellt. Die Fäden sind sehr dünn und gleichmäßig gesponnen.<br />
Das Fragment weist zwei unterschiedlich starke<br />
Webkanten auf: eine Webkante, bestehend aus einer Ripskante<br />
mit sieben Fäden, bildet das obere Anfangsband und<br />
die dünnere Webkante aus einer Leinwandbindung mit vier<br />
Fäden, den Seitenrand des Gewebes. Der leichte Verzug des<br />
Webstückes ist möglicherweise auf das Anbinden am Web-<br />
55