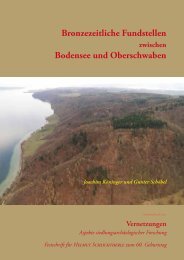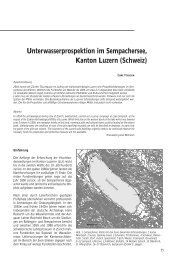Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ungskörner von Rand- und Bodenfragmenten liegt maximal<br />
zwischen 2 mm und 9 mm, für die beiden fundführenden<br />
Kulturschichten B und C errechnet sich ein Mittel<br />
von 5 mm. Die Magerungsart besteht bei der Keramik aus<br />
Schicht B durchgehend aus einer quarzreichen Steingrusmagerung,<br />
die Dichte der Magerung wirkt recht homogen.<br />
Die Fragmente in Schicht C weisen demgegenüber in einzelnen<br />
Fällen auch reinen Quarzgrus (Taf. 2,25.27) sowie<br />
stark glimmerführenden Grus (Taf. 2,26.28.31) auf. Ebenso<br />
sind Korngröße und Magerungsdichte unregelmäßiger.<br />
Magerungskomponenten wie Schamotte oder vegetabile<br />
Zusätze lässt der Allensbacher Keramikbestand nicht erkennen.<br />
Möglicherweise lassen sich weitere Magerungsbestandteile<br />
durch präzisere Untersuchungen mittels<br />
Dünnschliffanalysen belegen (vgl. Hardmeyer 1994, 66;<br />
Schlenker 1994, 124 ff).<br />
Aufbau<br />
Anhand von horizontalen Brüchen, die zuweilen wie „Nut<br />
und Kamm“ aufeinander passen, stellt die Bearbeiterin<br />
B. Hardmeyer für die Horgener Keramik von Zürich „Mozartstrasse“<br />
und Zürich „KanSan“ einen Aufbau in Wulsttechnik<br />
fest (Bleuer/Hardmeyer 1993, 277; Hardmeyer<br />
1994, 66). P. Suter beschreibt gleichartige Bruchformen im<br />
Horgener Keramikmaterial von Zürich „Kleiner Hafner“<br />
(Suter 1987, 140). M. Kolb erwägt aufgrund glatter, abgeschrägter<br />
Bruchkanten und mit Speiseresten verklebter,<br />
vertikaler Brüche für das Horgener Keramikspektrum von<br />
Sipplingen vorwiegend Lappentechnik (Kolb 1993, 177).<br />
Belege für Wulsttechnik gibt es dort ausschließlich in der<br />
ältesten Horgener Schicht (Schicht 11). In dem von A. Furger<br />
(1981) und M. Itten (1970) bearbeiteten Keramikmaterial<br />
sind keine Strukturen, die eine Wulsttechnik belegen<br />
könnten, aufgefallen.<br />
Im Allensbacher Keramikbestand sind kaum Nahtstellen<br />
auszumachen. Das Material ist in der Regel bröselig und<br />
stark zerscherbt. Die vorhandenen Bruchflächen sind sehr<br />
unregelmäßig. Weder können horizontale noch vertikale<br />
Nahtstellen, die auf Wülste, Bänder oder Lappentechnik<br />
hinweisen, festgestellt werden. Von zwei Gefäßprofilen, an<br />
denen die Brüche noch im Verband sind, lassen sich vorsichtige<br />
Aussagen ableiten (Abb. 43). Die Bruchzonen befinden<br />
sich jeweils in ca. 5 –7 cm großem Abstand voneinander,<br />
was der Höhe einer Aufbaureihe entsprechen könnte. Die<br />
innere Bruchkante liegt in der Regel tiefer als die äußere.<br />
Dies könnte auf von innen angedrückten Ton hinweisen,<br />
der außen nach oben gezogen wurde (vgl. Lüning/Zürn<br />
1977, 29; Bill 1983, 194).<br />
Einige Bodenscherben aus Schicht B und C geben Hinweise<br />
auf zwei verschiedene Techniken, Gefäßwand und Gefäßboden<br />
miteinander zu verbinden, wie dies auch Ch. Bollacher<br />
an der endneolithischen Keramik von Bad Buchau-<br />
Dullenried feststellen konnte (Abb. 44; vgl. Bollacher<br />
1999, 104; siehe dazu auch Schlichtherle 1995, 49 f.).<br />
Bruchfugen am Innenrand der Bodenscheibe, farbliche<br />
Unterschiede an der Oberfläche und rinnenartige Vertiefungen<br />
am Scheibenrand zeigen, dass einige Böden aus<br />
Schicht B als runde Platten vorgearbeitet wurden (Taf. 1,<br />
15,18). Anschließend konnten Wülste, Bänder oder Lappen<br />
für den Wandaufbau auf den Boden aufgesetzt werden<br />
(vgl. Furger 1981, 14). Dies ist besonders an den Böden<br />
mit großen Durchmessern, die zudem jeweils leicht abgesetzt<br />
sind, ersichtlich.<br />
Ein Gefäßprofil (Taf. 2,20), eine Wandscherbe mit Bodenansatz<br />
(Taf. 2,28) und zwei Bodenfragmente (Kat.-Nr.32;<br />
Kat.-Nr.33) aus Schicht C geben Aufschluss über eine zweite<br />
Art der Boden-Wandverbindung. Bei diesen Bodenfragmenten<br />
fehlen die Wandungsansätze, obwohl mit Kat.-Nr.<br />
33 ein fast kompletter Bodenteller vorliegt. Bruchstrukturen<br />
der Bodenscheibe deuten auf eine außen angebrachte<br />
und direkt an der Scheibe abgebrochene Wandung hin.<br />
Offenbar wurde die Gefäßwandung um die Bodenscheibe<br />
herum hochgezogen.<br />
Interessanterweise finden sich beide beschriebenen Techniken<br />
auch an Holzgefäßen aus Feldmeilen-Vorderfeld, die<br />
von J. Winiger in den Horgener Kontext gestellt wurden<br />
(Winiger 1981, Taf. 81,1.2). Verallgemeinernde Aussagen<br />
dürften sich aus diesen Aufbauarten bislang nicht ableiten<br />
lassen, möglicherweise kann ein umfassender Vergleich mit<br />
entsprechenden Materialkomplexen weitere Anhaltspunkte<br />
liefern. Unterschiede in den Bodenbefestigungen lassen<br />
sich indes zwischen der jungneolithischen Keramik des Federseegebietes<br />
zur Keramik der Horgener Kultur und auch<br />
zur jungneolithischen Keramik des Bodensees feststellen<br />
(Schlichtherle 1995, 49).<br />
Abb. 43: Allensbach-Strandbad. Schräglaufende Brüche im Keramikmaterial<br />
aus Schicht C.<br />
41