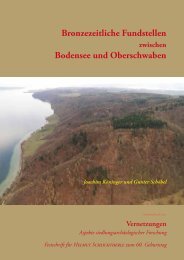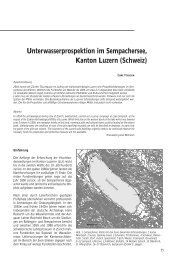Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rohmaterial<br />
Die Rohmaterialuntersuchung nahm 1988 freundlicherweise<br />
K. Burgath 19 vor, damals an der Bundesforschungsanstalt<br />
für Rohstoffe in Hannover tätig. Dabei wurden die Beilklingenfunde<br />
der Flächengrabungen 1986–1988 zuzüglich<br />
der in dieser Zeit aufgefundenen Oberflächenfunde erfasst.<br />
Weitere petrographische oder mineralogische Analysen<br />
wurden nicht durchgeführt. 23 der Beilklingen wurden als<br />
Serpentinit bestimmt, davon 16 Exemplare als Varietäten.<br />
Jeweils vier Klingen wurden aus Diabas und Kalkschiefer<br />
gefertigt, zwei aus Grauwacke und eine aus Gabbro. Eine<br />
Klinge blieb unbestimmt.<br />
Die Varietäten metamorpher Serpentinite sind schiefrig,<br />
von heller grüner Färbung, teils an den Rändern leicht<br />
durchscheinend und meist von weißlichen, glänzenden<br />
Strukturen durchzogen, da Asbest ein häufiges Begleitmineral<br />
ist. Dieses für die Steinbeilproduktion benutzte Gesteinsmaterial<br />
tritt etwa um 3150 v. Chr. im Verlauf der<br />
Horgener Kultur auf (Köninger 1999, 24 ff.) und kann als<br />
Edelserpentin bezeichnet werden (Abb. 49). 20 Der Terminus<br />
wird im Folgenden übernommen.<br />
Edelserpentine stehen in einigen Gebieten der Alpen an,<br />
sind im Alpenvorland aber nicht vertreten. Aufgrund ihres<br />
schiefrigen Gefüges sind sie nicht über weite Strecken hinweg<br />
transportfähig. Sie fehlen deshalb in den Geschieben<br />
des Rheingletschers und den Flusssystemen des Alpenrheins<br />
(Köninger/Schlichtherle 2001, 44). Als ein möglicher<br />
Herkunftsort gilt das Gebiet um den Piz Platta/Graubünden,<br />
in dessen weiterer Umgebung der Fundplatz Petrushügel<br />
bei Cazis liegt (Primas 1985). Zahlreich gefundene<br />
Edelserpentinklingen, Steinsägen und Produktionsreste<br />
machen diesen endneolithischen Fundplatz als Produktionsstätte<br />
für Edelserpentingeräte wahrscheinlich. In dieser<br />
Funktion könnte der Petrushügel bei Cazis Teil eines Gütertransfers<br />
ins Bodenseegebiet und nach Oberschwaben<br />
gewesen sein. Darauf verweisen – neben einem wahrscheinlich<br />
bereits jungneolithischen Bezugsnetz zwischen Oberschwaben<br />
und Norditalien über das Alpenrheintal – mehrere<br />
Fundstellen mit Edelserpentingeräten und -werkstücken<br />
entlang des Alpenrheins (Schlichtherle 1990b, 153 f.;<br />
ders. 1999, 44 ff.; Köninger/Schlichtherle 2001, 44 f.).<br />
Die Rohmaterialien der übrigen Beilklingen dürften aus<br />
den Schottern des Rheingletschers ausgelesen worden sein,<br />
wobei weitere Importstücke nicht auszuschließen sind.<br />
Bearbeitung<br />
Bis auf ein Halbfabrikat (Taf. 4,55) liegen aus der Produktionskette<br />
der Beilklingenherstellung keine weiteren Rohlinge<br />
oder Werkstücke vor. Das Halbfabrikat ist aus Kalkschiefer<br />
und wurde mittels Schlagtechnik zugerichtet. Auf<br />
den übrigen Beilklingen lassen sich als Bearbeitungstechniken<br />
Pickung, Schliff und Sägeschnitt unterscheiden.<br />
Pickung: Nahezu vollständig überpickt ist eine walzenförmige<br />
Beilklinge aus dem stratifizierten Fundbestand (Taf.<br />
7,82) und eine weitere ebenfalls walzenförmige Klinge, die<br />
unstratifiziert ist (Taf. 9,106). An zwei weiteren unstratifi-<br />
Schicht vollständig Nacken Schneide Halbfabrikat Sonstiges<br />
– 10 1 2<br />
_<br />
1<br />
Bef.<br />
2/3<br />
2 1 1<br />
_<br />
2<br />
C 4 1 – _ 2<br />
B 3 2 2 1<br />
_<br />
Tab. 5: Beilklingen aus den Grabungen 1984 –1988, aufgegliedert<br />
nach Schichtzugehörigkeit.<br />
Abb. 49: Auswahl an Edelserpentinklingen (Foto M. Erne).<br />
zierten Stücken (Taf. 9,109.111) ist eine deutliche, formbestimmende<br />
Pickung an Schmalseiten und Nacken festzustellen.<br />
Bei ersterem (Kat.-Nr. 109) sind die Schmalseiten<br />
durch die Überpickung einziehend gearbeitet.<br />
Schliff: Die Edelserpentine können durch Pickung kaum<br />
zugearbeitet werden, da dies zu Brüchen entlang ihres<br />
schiefrigen Gefüges führen würde. Entsprechend sind die<br />
Klingen, die oft noch Sägeschnittspuren aufweisen, alle<br />
partiell, flächig oder vollständig überschliffen (stratifizierte<br />
Klingen: Taf. 4,56.58; 7,85.86.87; 8,93.94.96). Aus den<br />
übrigen Materialklassen sind im stratifizierten Fundbestand<br />
zwei Fragmente von Großklingen (Taf. 4,52.54) aus<br />
körnigem Serpentinit vollständig überschliffen sowie ein<br />
kleines Nackenfragment (Taf. 7,88) aus Serpentinit oder<br />
Aphanit. Ebenso dürfte ein stark angewittertes Rechteckbeil<br />
vollständig überschliffen gewesen sein (Taf. 4,53). Zwei<br />
Abschlagklingen (Serpentinit, Diabas) sind flüchtig über-<br />
18 Zur Gliederung der Horgener Kultur siehe Gross/Ritzmann 1990,<br />
166 f.; Bleuer/Hardmeyer 1993, 285; Kolb 1993, Tab. 15.<br />
19 Die von K. Burgath bestimmten Gesteinsarten sind im Textteil des<br />
Katalogs mit einem Stern (*) gekennzeichnet.<br />
20 Vgl. dazu: Köninger/Schlichtherle 2001. Die Benennung geht<br />
auf den Petrografen K. Bächtiger, ETH Zürich zurück (Mottes/Nicolis/Schlichtherle<br />
2002, Anm. 46). Verallgemeinernd kann in<br />
den trüben Serpentin „Gemeiner Serpentin“, den Dekorstein „Edler<br />
Serpentin“ sowie den für feuerfeste Produkte verwendbaren „Chrysotilasbest“<br />
differenziert werden (Schuhmann 1991, 88).<br />
47