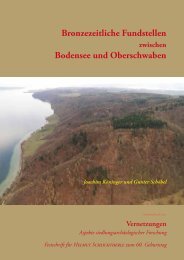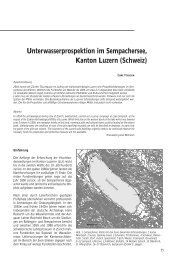Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Hemmenhofener Skripte - Janus Verlag
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Trennspuren aus Schicht B (Taf. 14A,153) kann aufgrund<br />
seiner Rohform als Tüllenfassung (Typ C nach Suter 1981)<br />
angesprochen werden. Tüllenzwischenfutter, die zum Einsatz<br />
kleiner Klingen und als Dämpfer zwischen Knieholm<br />
und Klinge verwendet wurden, gelten als älteste bekannte<br />
Schäftungsform mittels Geweihfutter (Gross-Klee/Schibler<br />
1995, 167; Billamboz/Schlichtherle 1999, 60 f.<br />
mit Anm. 32). Sie sind in Südwestdeutschland, der Zentral-<br />
und der Ostschweiz mit Beginn des Jungneolithikums<br />
häufig vertreten, fehlen jedoch in der späten Pfyner Kultur<br />
und im frühen Horgen. Schibler (1997, 198 f.) erklärt das<br />
Fehlen der Zwischenfutter hypothetisch durch Rohmaterialverknappung<br />
in Folge von Überjagung des Rothirsches.<br />
Erst mit der mittleren Horgener Kultur lassen sie sich wieder<br />
vereinzelt nachweisen. In der Westschweiz sind sie dagegen<br />
vom frühen Cortaillod bis in die Lüscherzer Kultur<br />
durchgängig vorhanden, vermehrt jedoch nur während der<br />
Lüscherzer Kultur belegt (Gross-Klee/Schibler 1995,<br />
Abb. 97; Hafner/Suter 2000, Abb. 102).<br />
Wie das bereits in Kapitel 5.2.2 vorgestellte Zwischenfutter<br />
aus der Grabung Allensbach-Strandbad 1983 dürften auch<br />
bei den beiden unstratifizierten Geweihstücken Fragmente<br />
von Zapfenzwischenfutter vorliegen. Erhalten hat sich ein<br />
3 cm langer Zapfen (Taf. 14C,158), der für den Einsatz in<br />
Stangenholmen geeignet ist. Bei dem zweiten, stark zersplitterten<br />
Fragment ist der Absatz zwischen Kranz und<br />
Zapfen erkennbar (Kat.-Nr.160). Weitere stratifizierte Horgener<br />
Zapfenzwischenfutter kommen mittlerweile aus der<br />
im Jahre 2003 durchgeführten Rettungsgrabung von Allensbach-Standbad<br />
hinzu (Müller/Schlichtherle 2003,<br />
38 ff. Abb. 19; s. Vorwort Schlichtherle).<br />
Am Bodensee sind Zapfenzwischenfutter der Horgener<br />
Kultur aus datierten Schichten von Sipplingen-Osthafen<br />
bekannt. Dort bleiben sie auf die ins späte Horgen datierte<br />
Schicht 15 beschränkt, wobei klemmgeschäftete Fassungen<br />
früher belegt sind (Schicht 13 und 14) als stiellochgeschäftete<br />
Fassungen (Schicht 14 und 15) (Kolb 1993, 227 ff.;<br />
Abb. 42; Tab. 15). Weitere stratifizierte Zapfenzwischenfutter<br />
stammen von der Späthorgener Ufersiedlung Bodman-Weiler<br />
II (Köninger im Druck).<br />
In der West- und Zentralschweiz sind Zapfenzwischenfutter<br />
ab dem 39. Jh. v. Chr. fassbar. Hierbei handelt es sich um<br />
durch Stangenholme gesteckte Sprossenfassungen (Typ A<br />
nach Suter 1981). 26 Die eingesetzte Variante (Typ B nach<br />
Suter 1981) entwickelte sich in der Westschweiz ab dem<br />
38. Jh. v. Chr. zu einer häufig genutzten Schäftungsart bei<br />
mittelgroßen Beilklingen. Mit dem 37. Jh. v. Chr. ist diese<br />
neue Zwischenfuttertechnologie auch in der Zentral- und<br />
Ostschweiz zu belegen. Sie bleibt in diesem Raum jedoch,<br />
wie schon die Tüllenfassungen im späten Pfyn und im frühen<br />
Horgen, aus. Erst mit dem 33. Jh. v. Chr. sind dort<br />
Zapfenzwischenfutter in einer technischen Erneuerung,<br />
der Klemmschäftung in Knieholmen, wieder zu belegen.<br />
Im 32. Jh. v. Chr. sind sie am Bodensee stratifiziert nachzuweisen<br />
(Sipplingen-Osthafen, Schicht 13–15). Um 3100 v.<br />
Chr. setzt erneut die Verwendung von Stangenholmen mit<br />
Zwischenfutter ein. Dagegen ist in der Westschweiz eine<br />
durchgehende Belegung der Zapfenzwischenfutter festzustellen,<br />
wobei die Klemmfassung erst in der Lüscherzer<br />
Kultur auftritt.<br />
6.9 Holzartefakte<br />
6.9.1 Beilholme<br />
Aus Schicht B stammt ein nahezu vollständig erhaltener<br />
Knieholm aus Eichenholz mit paralleler Schäftungsgabel<br />
(Taf. 15,161) (Abb. 54) (zur typologischen Gliederung der<br />
Beilholme s. Winiger 1991, 84 ff.). Der Griff ist radial aus<br />
dem Stammholz gespalten, die Schäftungsgabel ist aus dem<br />
Astabgang gefertigt. Die Aussparung in der Gabelschäftung<br />
ist sehr schmal, so dass sie nur für den Einsatz einer<br />
direkt geschäfteten und sehr schmalen Klinge gedient haben<br />
kann. Gegabelte Knieholme sind am Bodensee, in der<br />
Ost- und Zentralschweiz bereits in der späten Pfyner Kultur<br />
bekannt und während der Horgener Kultur häufig belegt<br />
(Kolb 1993, 303 ff.; Gross-Klee/Schibler 1995, Abb.<br />
97; Hafner/Suter 2000, Abb. 102; Leuzinger 2002, 80<br />
f.). An den Jurafußseen fallen Gabelholme im Jungneolithikum<br />
und im Westschweizer Horgen offenbar vollständig<br />
aus (Gross-Klee/Schibler 1995, Abb. 97; Hafner/Suter<br />
2000, Abb. 102).<br />
Kopf und Griffansatz eines quer geschäfteten weiteren Beilholms<br />
aus Schicht B stammen von einem zierlichen Knieholm<br />
mit direkt geschäfteter Steinklinge 27 (Taf. 15,162).<br />
Abb. 54: Allensbach-Strandbad, Schicht B. Knieholm mit paralleler<br />
Schäftungsgabel in Fundlage (Foto E. Czarnowski).<br />
53