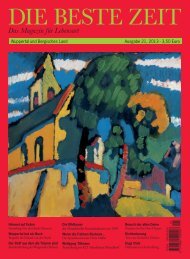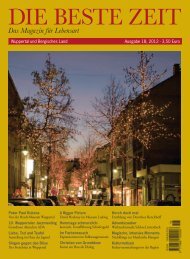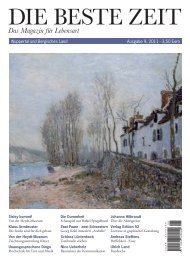Die Beste Zeit Nr. 16.indd - Druckservice HP Nacke KG
Die Beste Zeit Nr. 16.indd - Druckservice HP Nacke KG
Die Beste Zeit Nr. 16.indd - Druckservice HP Nacke KG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Frankfurter Rundschau. Der Zuhörer im<br />
ADA erfährt noch mehr: wie Literatur,<br />
Humor und Ironie zu Überlebensmitteln<br />
in schwer erträglichen <strong>Zeit</strong>en werden<br />
können. Samar Yazbek, die in ihrer<br />
Heimat Syrien Romane schrieb und als<br />
Journalistin arbeitete, dokumentierte die<br />
Protestbewegungen in ihrer Heimat. Als<br />
ihr Name auf der Todesliste der Geheimdienste<br />
auftauchte, tauchte sie ab und<br />
fl oh mit ihrer Tochter ins Ausland. Ihr<br />
Buch über ihre Erfahrungen im Gefängnis<br />
ist – wie der Titel – „ein Schrei nach<br />
Freiheit“, der bei den Zuhörern im ADA<br />
dort ankam, wo er hingehört: mitten ins<br />
Herz.<br />
Woher noch Stühle nehmen?<br />
Als der Künstlerische Beirat dieser ersten<br />
Wuppertaler Literatur Biennale zusammentraf,<br />
gab es sehr ernste und kritische<br />
Diskussionen zum Rahmenthema. Ob<br />
wohl ein solch dezidiert politisches Thema<br />
im Rahmen eines Literaturfestivals<br />
richtig verortet sei? Ob die Wuppertaler<br />
sich durch ein solches Thema – wenn<br />
hinten weit im Morgenland – bewegen<br />
lassen würden? <strong>Die</strong> Biennale hat gezeigt,<br />
dass sich die inneren und äußeren Wirklichkeiten<br />
durch nichts besser transportieren<br />
lassen als durch Literatur. <strong>Die</strong><br />
Wuppertaler haben sich bewegen lassen:<br />
Weit mehr als 3.000 Menschen kamen<br />
zu den 24 Veranstaltungen der Biennale.<br />
„Oft hatten wir das Problem, woher wir<br />
noch Stühle bekommen“, sagte Monika<br />
Heigermoser, Leiterin des Kulturbüros<br />
und Initiatorin der Literatur Biennale.<br />
Hinzu kamen 50 Schullesungen des VS,<br />
die in die Literatur Biennale eingebunden<br />
waren.<br />
Der Erfolg beruht wohl auch auf dem<br />
vom Beirat entwickelten Konzept, das<br />
Thema „Freiheit“ multiperspektivisch<br />
abzubilden. So las John van Düffel in<br />
der prall gefüllten Universitätsbibliothek<br />
aus seinem Roman „Houwelandt“, in<br />
dem es um das Ausbrechen aus verkrusteten<br />
Familienstrukturen geht. In<br />
der von der Wuppertaler Kulturjournalistin<br />
Anne Linsel sensibel moderierten<br />
Lesung mit der niederländischen<br />
Autorin Margriet de Moor portraitiert<br />
die Autorin eine junge Frau, die aus<br />
ihrer Heimat Dänemark in das Amsterdam<br />
Rembrandts reist. Ein Schrei<br />
nach Freiheit ist der Mord an ihrer<br />
Zimmerwirtin, den sie nicht bereuen<br />
kann und will. Sie wird zum Tode<br />
verurteilt. Wenige Stunden nach ihrer<br />
Hinrichtung zeichnet sie ein Rembrandt<br />
nachempfundener Maler; er will diesen<br />
Augen-Blick festhalten, den Verfall aufhalten,<br />
dem gewesenen Leben Ewigkeit,<br />
dem Tode Schönheit abtrotzen. Der<br />
Roman ist ein großartiges artistisches<br />
Spiel und zugleich ein Ringen um den<br />
Zusammenhang von Kunst und Leben.<br />
Gelungen war das Zusammenspiel von<br />
Musik und Lesung. Ein Trio für Alte<br />
Musik (Viola da Gamba, Gitarre und<br />
Cembola) entführte die Zuhörer auch<br />
atmosphärisch in die <strong>Zeit</strong> des 17. Jahrhunderts.<br />
Musik und Wort<br />
Überhaupt erwies sich die musikalische<br />
Kontextualisierung der Literatur<br />
als ein gelungener Baustein dieser<br />
ersten Wuppertaler Literatur Biennale.<br />
Besonders beeindruckend war<br />
das „Zusammenspiel“ zwischen dem<br />
Jörg Degenkolb-Deg˘erli Karl Otto Mühl Michael Zeller<br />
Bassisten und Improvisationsmusiker<br />
Harald Eller und Christoph Ramsmayr,<br />
der im Barmer Bahnhof aus seinem<br />
Roman „Morbus Kitahara“ las und die<br />
Zuschauer in eine apokalyptische Welt<br />
nach einem fiktiven Krieg entführte,<br />
in der sich die Sieger an den früheren<br />
Peinigern rächen. <strong>Die</strong> beklemmenden<br />
Stimmungen, Bilder und Geschichten,<br />
aufgebaut aus komplexen Satzkaskaden<br />
und in einer filmisch bildhaften Sprache,<br />
spiegelte Eller in seinen Bass-Soli<br />
atmosphärisch präzise wieder.<br />
Zu dem Konzept der Biennale gehörte<br />
von Anfang an, neben Großautoren<br />
wie Christoph Ransmayr, Margriet de<br />
Moor und Literaturnobelpreisträgerin<br />
Herta Müller auch den Wuppertaler<br />
Autoren Gehör zu verleihen. Denn die<br />
Wuppertaler Literaturszene war und<br />
ist lebendig. Karl Otto Mühl, Jahrgang<br />
1923, Nestor der Wuppertaler<br />
Literaten, trat im Slam Poetry Wettbewerb<br />
gegen die Enkel-Generation<br />
Jörg Degenkolb-Degerli und Andre<br />
Wiesler an. Altersunterschied: 50<br />
Jahre. Herrmann Schulz, langjähriger<br />
Leiter des Wuppertaler Peter-Hammer-<br />
Verlages, Autor zahlreicher Romane<br />
und Jugendbücher betrat ebenfalls die<br />
„Generation-Stage“ und ließ sich auf<br />
die Kunst des schnell wirksamen Wortes<br />
ein. Der Wuppertaler Schriftsteller<br />
Michael Zeller, von der Heydt- und<br />
Andreas-Gryphius-Preisträger, erörterte<br />
mit seinen Kollegen Artur Becker<br />
und Dariusz Muzer – alle drei wurden<br />
in Polen geboren – die vielfältigen<br />
Formen der Zensur im Polen des real<br />
existierenden Kommunismus.<br />
13