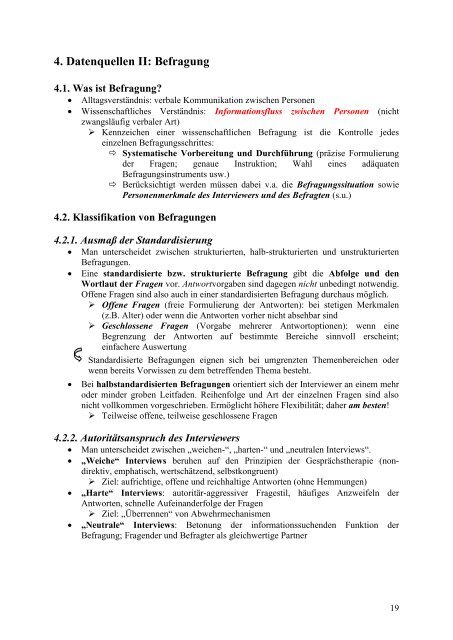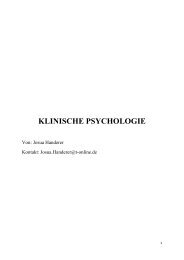FORSCHUNGSMETHODEN
FORSCHUNGSMETHODEN
FORSCHUNGSMETHODEN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4. Datenquellen II: Befragung<br />
4.1. Was ist Befragung?<br />
Alltagsverständnis: verbale Kommunikation zwischen Personen<br />
Wissenschaftliches Verständnis: Informationsfluss zwischen Personen (nicht<br />
zwangsläufig verbaler Art)<br />
Kennzeichen einer wissenschaftlichen Befragung ist die Kontrolle jedes<br />
einzelnen Befragungsschrittes:<br />
Systematische Vorbereitung und Durchführung (präzise Formulierung<br />
der Fragen; genaue Instruktion; Wahl eines adäquaten<br />
Befragungsinstruments usw.)<br />
Berücksichtigt werden müssen dabei v.a. die Befragungssituation sowie<br />
Personenmerkmale des Interviewers und des Befragten (s.u.)<br />
4.2. Klassifikation von Befragungen<br />
4.2.1. Ausmaß der Standardisierung<br />
Man unterscheidet zwischen strukturierten, halb-strukturierten und unstrukturierten<br />
Befragungen.<br />
Eine standardisierte bzw. strukturierte Befragung gibt die Abfolge und den<br />
Wortlaut der Fragen vor. Antwortvorgaben sind dagegen nicht unbedingt notwendig.<br />
Offene Fragen sind also auch in einer standardisierten Befragung durchaus möglich.<br />
Offene Fragen (freie Formulierung der Antworten): bei stetigen Merkmalen<br />
(z.B. Alter) oder wenn die Antworten vorher nicht absehbar sind<br />
Geschlossene Fragen (Vorgabe mehrerer Antwortoptionen): wenn eine<br />
Begrenzung der Antworten auf bestimmte Bereiche sinnvoll erscheint;<br />
einfachere Auswertung<br />
Standardisierte Befragungen eignen sich bei umgrenzten Themenbereichen oder<br />
wenn bereits Vorwissen zu dem betreffenden Thema besteht.<br />
Bei halbstandardisierten Befragungen orientiert sich der Interviewer an einem mehr<br />
oder minder groben Leitfaden. Reihenfolge und Art der einzelnen Fragen sind also<br />
nicht vollkommen vorgeschrieben. Ermöglicht höhere Flexibilität; daher am besten!<br />
Teilweise offene, teilweise geschlossene Fragen<br />
4.2.2. Autoritätsanspruch des Interviewers<br />
Man unterscheidet zwischen „weichen-“, „harten-“ und „neutralen Interviews“.<br />
„Weiche“ Interviews beruhen auf den Prinzipien der Gesprächstherapie (nondirektiv,<br />
emphatisch, wertschätzend, selbstkongruent)<br />
Ziel: aufrichtige, offene und reichhaltige Antworten (ohne Hemmungen)<br />
„Harte“ Interviews: autoritär-aggressiver Fragestil, häufiges Anzweifeln der<br />
Antworten, schnelle Aufeinanderfolge der Fragen<br />
Ziel: „Überrennen“ von Abwehrmechanismen<br />
„Neutrale“ Interviews: Betonung der informationssuchenden Funktion der<br />
Befragung; Fragender und Befragter als gleichwertige Partner<br />
19