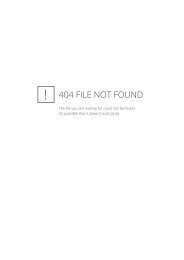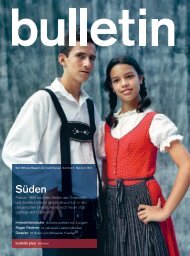Durchbruch - Credit Suisse eMagazine - Deutschland
Durchbruch - Credit Suisse eMagazine - Deutschland
Durchbruch - Credit Suisse eMagazine - Deutschland
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Foto: Image Source, Getty Images<br />
<strong>Durchbruch</strong> und Innovationen 07<br />
Entdeckungen werden dann gemacht, wenn die Zeit dafür reif ist. Darum hat so mancher<br />
originelle Einfall mehrere Väter. Ob jemand mit einer Idee oder einem Produkt<br />
den <strong>Durchbruch</strong> schafft, hängt aber nicht unbedingt davon ab, ob er als Erster darauf<br />
gekommen ist.<br />
Text: Mathias Plüss<br />
<strong>Deutschland</strong>, 1895. Ein Glasbläser fertigt drei identische Röhren,<br />
verpackt sie einzeln und verschickt sie an drei Physiker. Zwei Röhren<br />
gehen unterwegs zu Bruch – die dritte erhält Wilhelm Conrad Röntgen,<br />
der mit ihrer Hilfe seine berühmten Strahlen entdeckt. «Es ist<br />
also lediglich ein postalischer Zufall, dass es Röntgenstrahlen gibt<br />
und keine Hallwachsstrahlen», kommentierte Wilhelm Hallwachs, der<br />
eine der beiden zerbrochenen Röhren erhalten hatte. Ein Scherz?<br />
Gewiss. Aber er enthält einen wahren Kern. Röntgen experimentierte<br />
nicht als Einziger mit Glasröhren; mindestens drei Physiker hatten<br />
schon vor ihm die gleichen Strahlen erzeugt, aber hielten das, was<br />
sie sahen, nicht für etwas Neues, sondern für einen Dreckeffekt.<br />
Wie kommt es zu Durchbrüchen in Wissenschaft und Technik?<br />
Sind Entdeckungen Geniestreiche oder geschehen sie einfach, wenn<br />
die Zeit dafür reif ist ? Im Fall von Röntgen kann man sagen: Ja, es<br />
steckte experimentelles Geschick dahinter, auch Beobachtungsgabe<br />
und die Kunst, aus dem Beobachteten die richtigen Schlüsse zu<br />
ziehen. Wir dürfen aber auch, ohne seine Leistung zu schmälern,<br />
sagen: Die Röntgenstrahlen wären auch ohne Röntgen entdeckt<br />
worden. Vermutlich nicht einmal besonders viel später.<br />
Kollektiver Wissenschaftsbetrieb<br />
Wir stellen uns Wissenschaftler gerne als einsame Genies vor, die<br />
wie Schriftsteller quasi aus dem Nichts etwas Neues erschaffen.<br />
Doch der romantische Vergleich hinkt: Der Wissenschaftsbetrieb<br />
funktioniert kollektiv, die Forscher sind untereinander hochgradig<br />
vernetzt, und oft versammeln sich – das Beispiel Röntgen zeigt es –<br />
viele Akteure um eine einzige Entdeckung. In der Literatur hingegen<br />
kommt alles auf die Fantasie des Einzelnen an. Goethe hat diesen<br />
Unterschied klar erkannt, als er erklärte, warum sich Wissenschaftler<br />
oft so heftig um die Priorität einer Entdeckung streiten: In der<br />
Literatur, schrieb er, könne «ein einziger Gedanke das Fundament<br />
zu hundert Epigrammen hergeben, und es fragt sich bloss, welcher<br />
Poet denn nun diesen Gedanken auf die wirksamste und schönste<br />
Weise zu versinnlichen gewusst habe. Bei der Wissenschaft aber ist<br />
die Behandlung null, und alle Wirkung liegt im Aperçu.»<br />
Kann man sich «Die Verwandlung» ohne Kafka vorstellen? Sicher<br />
nicht. Kann man sich die Glühbirne ohne Edison vorstellen? Bestimmt.<br />
Mehr noch: Die ersten Glühlampen tauchten schon um 1820<br />
auf – 60 Jahre, bevor Edison sein berühmtes Patent erhielt. Edison<br />
hat die Glühbirne entscheidend verbessert und erfolgreich vermarktet,<br />
aber ihn als deren «Erfinder» zu bezeichnen, ist eigentlich falsch.<br />
Noch extremer ist der Fall beim Telefon, das mindestens fünfmal<br />
«erfunden» worden ist. Alexander Graham Bell, der heute meist als<br />
Erfinder genannt wird, kam am 14. Februar 1876 mit seinem Patentantrag<br />
dem amerikanischen Handwerker Elisha Gray um gerade mal<br />
zwei Stunden zuvor.<br />
Etwas liegt in der Luft<br />
Es gibt mehrere hundert Beispiele von «gleichzeitigen» Erfindungen.<br />
Sie sind ein Beweis dafür, dass Durchbrüche eben oft nicht das<br />
Resultat individueller Geniestreiche sind, sondern vielmehr dann<br />
geschehen, wenn sie in der Luft liegen: Wenn nämlich die Rahmenbedingungen<br />
stimmen, die nötigen Vorarbeiten gemacht sind und<br />
Bedarf danach besteht. «Es ist offenkundig, dass die gleiche Entdeckung<br />
oft gleichzeitig und ziemlich unabhängig von verschiedenen<br />
Personen gemacht wird», schrieb der britische Statistiker und Psychologe<br />
Francis Galton. «Es scheint, dass Entdeckungen gewöhnlich<br />
dann gemacht werden, wenn die Zeit reif für sie ist – das heisst,<br />
wenn die Ideen, aus denen sie hervorgehen, in den Köpfen vieler<br />
Menschen gären.»<br />
Stellt sich die Frage, ob sich das Phänomen der gleichzeitigen<br />
Entdeckung womöglich auf kleine Durchbrüche beschränkt? Erstaunlicherweise<br />
nicht. Gerade bei den grossartigsten Theorien von<br />
Physik, Biologie und Mathematik gibt es Vorgänge von verblüffender<br />
Parallelität.<br />
beit<br />
von Albert Einstein aus dem Jahr 1905. Doch der französische<br />
Mathematiker Henri Poincaré war auch sehr nahe dran – er hatte<br />
schon die richtigen Gleichungen gefunden und bereits 1904 das<br />
Relativitätsprinzip formuliert. Bis heute wird Einstein deswegen ><br />
<strong>Credit</strong> <strong>Suisse</strong> Bulletin 1/09