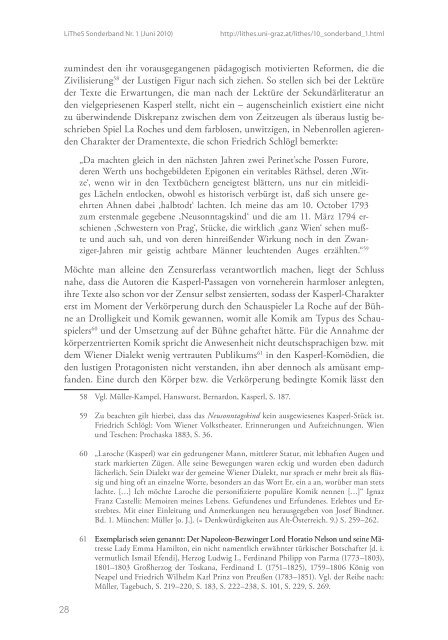Jennyfer Großauer-Zöbinger - bei LiTheS
Jennyfer Großauer-Zöbinger - bei LiTheS
Jennyfer Großauer-Zöbinger - bei LiTheS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>LiTheS</strong> Sonderband Nr. 1 (Juni 2010)<br />
28<br />
http://lithes.uni-graz.at/lithes/10_sonderband_1.html<br />
zumindest den ihr vorausgegangenen pädagogisch motivierten Reformen, die die<br />
Zivilisierung 58 der Lustigen Figur nach sich ziehen. So stellen sich <strong>bei</strong> der Lektüre<br />
der Texte die Erwartungen, die man nach der Lektüre der Sekundärliteratur an<br />
den vielgepriesenen Kasperl stellt, nicht ein – augenscheinlich existiert eine nicht<br />
zu überwindende Diskrepanz zwischen dem von Zeitzeugen als überaus lustig beschrieben<br />
Spiel La Roches und dem farblosen, unwitzigen, in Nebenrollen agierenden<br />
Charakter der Dramentexte, die schon Friedrich Schlögl bemerkte:<br />
„Da machten gleich in den nächsten Jahren zwei Perinet’sche Possen Furore,<br />
deren Werth uns hochgebildeten Epigonen ein veritables Räthsel, deren ,Witze‘,<br />
wenn wir in den Textbüchern geneigtest blättern, uns nur ein mitleidiges<br />
Lächeln entlocken, obwohl es historisch verbürgt ist, daß sich unsere geehrten<br />
Ahnen da<strong>bei</strong> ,halbtodt‘ lachten. Ich meine das am 10. October 1793<br />
zum erstenmale gegebene ,Neusonntagskind‘ und die am 11. März 1794 erschienen<br />
,Schwestern von Prag‘, Stücke, die wirklich ,ganz Wien‘ sehen mußte<br />
und auch sah, und von deren hinreißender Wirkung noch in den Zwanziger-Jahren<br />
mir geistig achtbare Männer leuchtenden Auges erzählten.“ 59<br />
Möchte man alleine den Zensurerlass verantwortlich machen, liegt der Schluss<br />
nahe, dass die Autoren die Kasperl-Passagen von vorneherein harmloser anlegten,<br />
ihre Texte also schon vor der Zensur selbst zensierten, sodass der Kasperl-Charakter<br />
erst im Moment der Verkörperung durch den Schauspieler La Roche auf der Bühne<br />
an Drolligkeit und Komik gewannen, womit alle Komik am Typus des Schauspielers<br />
60 und der Umsetzung auf der Bühne gehaftet hätte. Für die Annahme der<br />
körperzentrierten Komik spricht die Anwesenheit nicht deutschsprachigen bzw. mit<br />
dem Wiener Dialekt wenig vertrauten Publikums 61 in den Kasperl-Komödien, die<br />
den lustigen Protagonisten nicht verstanden, ihn aber dennoch als amüsant empfanden.<br />
Eine durch den Körper bzw. die Verkörperung bedingte Komik lässt den<br />
58 Vgl. Müller-Kampel, Hanswurst, Bernardon, Kasperl, S. 187.<br />
59 Zu beachten gilt hier<strong>bei</strong>, dass das Neusonntagskind kein ausgewiesenes Kasperl-Stück ist.<br />
Friedrich Schlögl: Vom Wiener Volkstheater. Erinnerungen und Aufzeichnungen. Wien<br />
und Teschen: Prochaska 1883, S. 36.<br />
60 „Laroche (Kasperl) war ein gedrungener Mann, mittlerer Statur, mit lebhaften Augen und<br />
stark markierten Zügen. Alle seine Bewegungen waren eckig und wurden eben dadurch<br />
lächerlich. Sein Dialekt war der gemeine Wiener Dialekt, nur sprach er mehr breit als flüssig<br />
und hing oft an einzelne Worte, besonders an das Wort Er, ein a an, worüber man stets<br />
lachte. […] Ich möchte Laroche die personifizierte populäre Komik nennen […]“ Ignaz<br />
Franz Castelli: Memoiren meines Lebens. Gefundenes und Erfundenes. Erlebtes und Erstrebtes.<br />
Mit einer Einleitung und Anmerkungen neu herausgegeben von Josef Bindtner.<br />
Bd. 1. München: Müller [o. J.]. (= Denkwürdigkeiten aus Alt-Österreich. 9.) S. 259–262.<br />
61 Exemplarisch seien genannt: Der Napoleon-Bezwinger Lord Horatio Nelson und seine Mä-<br />
Exemplarisch seien genannt: Der Napoleon-Bezwinger Lord Horatio Nelson und seine Mätresse<br />
Lady Emma Hamilton, ein nicht namentlich erwähnter türkischer Botschafter [d. i.<br />
vermutlich Ismail Efendi], Herzog Ludwig I., Ferdinand Philipp von Parma (1773–1803),<br />
1801–1803 Großherzog der Toskana, Ferdinand I. (1751–1825), 1759–1806 König von<br />
Neapel und Friedrich Wilhelm Karl Prinz von Preußen (1783–1851). Vgl. der Reihe nach:<br />
Müller, Tagebuch, S. 219–220, S. 183, S. 222–238, S. 101, S. 229, S. 269.