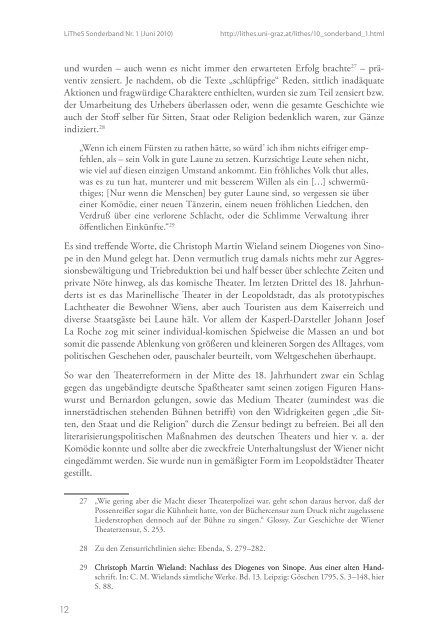Jennyfer Großauer-Zöbinger - bei LiTheS
Jennyfer Großauer-Zöbinger - bei LiTheS
Jennyfer Großauer-Zöbinger - bei LiTheS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
12<br />
<strong>LiTheS</strong> Sonderband Nr. 1 (Juni 2010)<br />
http://lithes.uni-graz.at/lithes/10_sonderband_1.html<br />
und wurden – auch wenn es nicht immer den erwarteten Erfolg brachte 27 – präventiv<br />
zensiert. Je nachdem, ob die Texte „schlüpfrige“ Reden, sittlich inadäquate<br />
Aktionen und fragwürdige Charaktere enthielten, wurden sie zum Teil zensiert bzw.<br />
der Umar<strong>bei</strong>tung des Urhebers überlassen oder, wenn die gesamte Geschichte wie<br />
auch der Stoff selber für Sitten, Staat oder Religion bedenklich waren, zur Gänze<br />
indiziert. 28<br />
„Wenn ich einem Fürsten zu rathen hätte, so würd’ ich ihm nichts eifriger empfehlen,<br />
als – sein Volk in gute Laune zu setzen. Kurzsichtige Leute sehen nicht,<br />
wie viel auf diesen einzigen Umstand ankommt. Ein fröhliches Volk thut alles,<br />
was es zu tun hat, munterer und mit besserem Willen als ein […] schwermüthiges;<br />
[Nur wenn die Menschen] bey guter Laune sind, so vergessen sie über<br />
einer Komödie, einer neuen Tänzerin, einem neuen fröhlichen Liedchen, den<br />
Verdruß über eine verlorene Schlacht, oder die Schlimme Verwaltung ihrer<br />
öffentlichen Einkünfte.“ 29<br />
Es sind treffende Worte, die Christoph Martin Wieland seinem Diogenes von Sinope<br />
in den Mund gelegt hat. Denn vermutlich trug damals nichts mehr zur Aggressionsbewältigung<br />
und Triebreduktion <strong>bei</strong> und half besser über schlechte Zeiten und<br />
private Nöte hinweg, als das komische Theater. Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts<br />
ist es das Marinellische Theater in der Leopoldstadt, das als prototypisches<br />
Lachtheater die Bewohner Wiens, aber auch Touristen aus dem Kaiserreich und<br />
diverse Staatsgäste <strong>bei</strong> Laune hält. Vor allem der Kasperl-Darsteller Johann Josef<br />
La Roche zog mit seiner individual-komischen Spielweise die Massen an und bot<br />
somit die passende Ablenkung von größeren und kleineren Sorgen des Alltages, vom<br />
politischen Geschehen oder, pauschaler beurteilt, vom Weltgeschehen überhaupt.<br />
So war den Theaterreformern in der Mitte des 18. Jahrhundert zwar ein Schlag<br />
gegen das ungebändigte deutsche Spaßtheater samt seinen zotigen Figuren Hanswurst<br />
und Bernardon gelungen, sowie das Medium Theater (zumindest was die<br />
innerstädtischen stehenden Bühnen betrifft) von den Widrigkeiten gegen „die Sitten,<br />
den Staat und die Religion“ durch die Zensur bedingt zu befreien. Bei all den<br />
literarisierungspolitischen Maßnahmen des deutschen Theaters und hier v. a. der<br />
Komödie konnte und sollte aber die zweckfreie Unterhaltungslust der Wiener nicht<br />
eingedämmt werden. Sie wurde nun in gemäßigter Form im Leopoldstädter Theater<br />
gestillt.<br />
27 „Wie gering aber die Macht dieser Theaterpolizei war, geht schon daraus hervor, daß der<br />
Possenreißer sogar die Kühnheit hatte, von der Büchercensur zum Druck nicht zugelassene<br />
Liederstrophen dennoch auf der Bühne zu singen.“ Glossy, Zur Geschichte der Wiener<br />
Theaterzensur, S. 253.<br />
28 Zu den Zensurrichtlinien siehe: Ebenda, S. 279–282.<br />
29 Christoph Martin Wieland: Nachlass des Diogenes von Sinope. Aus einer alten Hand-<br />
Christoph Martin Wieland: Nachlass des Diogenes von Sinope. Aus einer alten Handschrift.<br />
In: C. M. Wielands sämtliche Werke. Bd. 13. Leipzig: Göschen 1795, S. 3–148, hier<br />
S. 88.