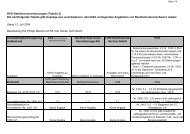Entwurf_Titel_2 1..1 - Anwaltsblatt - Deutscher Anwaltverein
Entwurf_Titel_2 1..1 - Anwaltsblatt - Deutscher Anwaltverein
Entwurf_Titel_2 1..1 - Anwaltsblatt - Deutscher Anwaltverein
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AnwBl 8 + 9/2004 525<br />
Rechtsprechung MN<br />
hebliche Korrekturmöglichkeiten geben, um eine Verfahrenswiederholung<br />
aus formellen Gründen zu vermeiden.<br />
bb) Erst recht ist dieses Verfahren dann sinnvoll, wenn die erste<br />
Instanz die Verwaltungsentscheidung bereits bestätigt hat. Dann<br />
kann und sollte auch eine weiter eingeschaltete Instanz – bei Notarzulassungssachen<br />
der BGH – in der Sache entscheiden. Vielen<br />
Bewerbern kann es nicht zugemutet werden, dass sie auf eine Neuausschreibung<br />
vertröstet werden. Auch wenn sie mangels positiver<br />
Entscheidung seitens der Landesjustizverwaltung keinen uneingeschränkten<br />
Rechtsanspruch auf Fortsetzung des Verfahrens haben,<br />
so können durch den Abbruch und die Neuausschreibung nach<br />
dem oben Gesagten ihre Grundrechte verletzt werden.<br />
In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass<br />
nicht selten bei gerichtlich anhängigen Konkurrenten„klagen“ zahlreiche<br />
Stellen bereits vergeben wurden und nur noch über einen<br />
„Restposten“ zwischen zwei Bewerbern zu entscheiden ist. Die in<br />
laufenden Verfahren nach den neuen Kriterien des BVerfG aussichtsreichen<br />
Bewerber wären daher bei einem Abbruch des Verfahrens<br />
durch die Landesjustizverwaltung mehrfach benachteiligt,<br />
da sie sich zum einen nur noch einem beschränkten Bewerberkreis<br />
stellen können, hingegen zahlreiche frühere Mitbewerber schon im<br />
Besitz der Notarzulassung sind, welche ihnen nicht mehr weggenommen<br />
werden kann, obwohl sie nach den Kriterien des<br />
BVerfG eigentlich im Vergleich zu ihnen nicht hätten berücksichtigt<br />
werden dürfen. Zudem müssten sie sich in einem neuen Verfahren<br />
mit weiteren Bewerbern auseinander setzen.<br />
4. In jedem Fall besteht nach der Grundsatzentscheidung des<br />
BVerfG bis zur Neukonzeption der Zulassungsvoraussetzungen eine<br />
erhebliche Rechtsunsicherheit. Alle Bewerber müssen mit Verzögerungen<br />
rechnen, was sicherlich vielfach sehr schmerzlich ist.<br />
Andererseits sollte nicht übersehen werden, dass die Entscheidung<br />
des BVerfG politisch langfristig eine nicht unerhebliche Stärkung<br />
des Anwaltsnotariats zur Folge haben kann. Schließlich wird bei<br />
Befolgung der verfassungsgerichtlichen Vorgaben eine bedeutsame<br />
Schwäche dieser Notarform, welche die Zulassungsvoraussetzungen<br />
und damit die Qualität betraf, beseitigt. Je notarspezifischer<br />
die Zulassungsvoraussetzungen sind, je stärker auf die Eignung für<br />
das konkrete Amt geachtet wird, desto geringer sind nach dem bisherigen<br />
System nicht zu leugnende Qualitätsdefizite gerade und<br />
auch im Vergleich zum Nur-Notariat. Anzustreben ist jedoch eine<br />
bundeseinheitliche Regelung. Im Berufsrecht der freien Berufe einschließlich<br />
der Notare ist schon unter europarechtlichen Gesichtspunkten<br />
angesichts der Öffnung der nationalen Dienstleistungsmärkte<br />
kein Platz mehr für einen kleinkarierten berufsrechtlichen<br />
Provinzialismus.<br />
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.<br />
GG Art. 12 Abs. 1; BNotO § 50 Abs. 1 Nr. 6; BVerfGG § 32<br />
Abs. 1, Abs. 2 S. 2<br />
Zur maßgeblichen Sach- und Rechtslage bei Amtsenthebung<br />
von Notaren (hier wegen Vermögensverfalls). (Leitsatz der Redaktion)<br />
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senates), Beschl. vom<br />
28.04.2004 – 1 BvR 912/04<br />
Aus den Gründen: I. Der Beschwerdeführer wendet sich mit<br />
seinem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen<br />
seine Enthebung aus dem Amt des Notars.<br />
1. Im November 2002 wurde über das Vermögen des Beschwerdeführers,<br />
der seit 1991 Notar in Sachsen ist, wegen Zahlungsunfähigkeit<br />
das Insolvenzverfahren eröffnet. Nachdem im Februar 2003<br />
eine Gläubigerversammlung stattgefunden hatte, bei welcher die<br />
vorläufige Fortführung des „Unternehmens“ des Beschwerdeführers<br />
beschlossen und der Insolvenzverwalter beauftragt worden<br />
war, einen Insolvenzplan zu erstellen, enthob das Sächsische<br />
Staatsministerium der Justiz den Beschwerdeführer nach Anhörung<br />
mit Bescheid v. 20.3.2003 seines Amtes.<br />
Im Juli 2003 wurde der mittlerweile aufgestellte Insolvenzplan<br />
durch das Insolvenzgericht bestätigt. Mit Beschluss v. 23.8.2003<br />
hob das OLG den Bescheid v. 20.3.2003 auf und setzte die Vollziehung<br />
der Amtsenthebung bis zum rechtskräftigen Abschluss des<br />
Verfahrens aus. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, die<br />
aus der Eröffnung des Insolvenzverfahrens abgeleitete Vermutung<br />
des Vermögensverfalls sei bereits bei Erlass der angefochtenen<br />
Entscheidung durch den Beschluss der Gläubigerversammlung im<br />
Februar 2003 widerlegt gewesen.<br />
Der sofortigen Beschwerde des Sächsischen Staatsministeriums<br />
der Justiz gab der BGH mit dem am 2.4.2004 zugestellten Beschl.<br />
v. 23.3.2004 statt. Die Amtsenthebung des Beschwerdeführers sei<br />
gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 6 der Bundesnotarordnung (BNotO) zu<br />
Recht erfolgt. Die Ergebnisse der Gläubigerversammlung im Februar<br />
2003 hätten die Vermutung des Vermögensfalls durch Eröffnung<br />
des Insolvenzverfahrens nicht entkräftet. Zwar spreche nach<br />
Erstellung des Insolvenzplans vieles dafür, dass der Beschwerdeführer<br />
nunmehr die gegen ihn gerichteten Forderungen in einer<br />
Weise erfüllen könne, die seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse<br />
wieder als geordnet erscheinen ließen, doch könnten der<br />
Amtsenthebung nachfolgende Veränderungen der Sachlage nicht<br />
berücksichtigt werden, weil bei der Überprüfung gestaltender Verwaltungsakte<br />
aus Gründen der Rechtssicherheit spätere Veränderungen<br />
der Sachlage außer Betracht bleiben müssten.<br />
Mit Schriftsatz v. 28.4.2004 erhob der Beschwerdeführer fristgerecht<br />
Verfassungsbeschwerde und stellte zugleich einen Antrag<br />
auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Er macht geltend, dass<br />
Gründe der Rechtssicherheit den schweren Eingriff in seine Berufswahlfreiheit<br />
nicht rechtfertigen könnten.<br />
II. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, über<br />
den wegen Eilbedürftigkeit ohne Anhörung der Gegenseite entschieden<br />
werden konnte (vgl. § 32 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG), hat Erfolg.<br />
1. Nach § 33 Abs. 1 BVerfGG kann das BVerfG einen Zustand<br />
durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr<br />
schwerer Nachteile oder aus einem anderen wichtigen Grund<br />
zum Gemeinwohl dringend geboten ist. Dabei haben die Gründe,<br />
die für die Verfassungswidrigkeit des angegriffenen Hoheitsaktes<br />
vorgetragen werden, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben, es<br />
sei denn, die Verfassungsbeschwerde wäre unzulässig oder offensichtlich<br />
unbegründet. Bei offenem Ausgang muss das BVerfG die<br />
Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung<br />
nicht erginge, die Verfassungsbeschwerde aber Erfolg hätte, gegenüber<br />
den Nachteilen abwägen, die entstünden, wenn die begehrte<br />
einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde<br />
aber der Erfolg zu versagen wäre (vgl. BVerfGE 88,<br />
169 [171 f.]; 91, 328 [332]; st. Rspr.).<br />
2. a) Die Verfassungsbeschwerde ist weder unzulässig noch in<br />
Bezug auf die Rüge der Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG offensichtlich<br />
unbegründet. Die Grundrechtsfrage hat der BGH nur am<br />
Rande erörtert; sie bedarf der Prüfung im Hauptsacheverfahren.<br />
b) Die danach gebotene Folgenabwägung führt vorliegend zu<br />
einem Überwiegen derjenigen Gründe, die für den Erlass der beantragten<br />
einstweiligen Anordnung sprechen.<br />
Unterbliebe die einstweilige Anordnung, hätte die Verfassungsbeschwerde<br />
aber Erfolg, müsste der Beschwerdeführer seinen Beruf<br />
aufgeben, ohne dass sicher ist, dass er ihn nach einem Erfolg in<br />
der Hauptsache wieder aufnehmen könnte.<br />
Wird die einstweilige Anordnung erlassen, hat die Verfassungsbeschwerde<br />
aber später keinen Erfolg, bleibt der Beschwerdeführer –<br />
wie schon infolge der Entscheidung des OLG – vorübergehend weiterhin<br />
im Amt. Da vieles dafür spricht, dass er infolge des aufgestellten<br />
Insolvenzplans wieder in geordneten Einkommens- und Vermögensverhältnissen<br />
lebt, und seine Amtsführung überdies nach dem<br />
Prüfbericht aus Februar 2003 zu Beanstandungen keinen Anlass geboten<br />
hat, bestehen hiergegen keine durchgreifenden Bedenken.<br />
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack,<br />
Freiburg i. Br.<br />
Anmerkung der Redaktion: Das Bundesverfassungsgericht<br />
wird in der Hauptsache zu entscheiden haben, ob die Rechtsprechung<br />
des BGH einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhält,<br />
nach der Änderungen der Sach- und Rechtslage nach Abschluss<br />
des Verwaltungsverfahrens im gerichtlichen Verfahren nicht<br />
mehr zu berücksichtigen sind. Vergleichbare Probleme stellen sich<br />
nicht nur bei der Amtsenthebung von Notaren sondern auch beim<br />
Widerruf der Zulassung bzw. Approbation sowie bei gewerberechtlichen<br />
Untersagungsverfügungen. Die vorausgehende Entscheidung<br />
des BGH findet sich in NJW 2004, 2018.