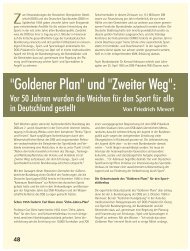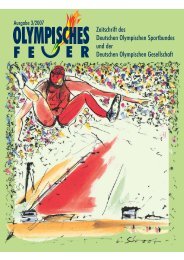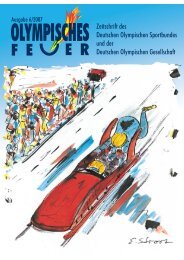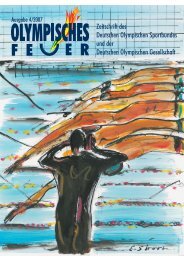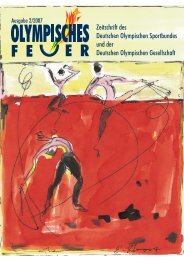Ausgabe 1/2013 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 1/2013 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Ausgabe 1/2013 - Deutsche Olympische Gesellschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
sondern Abbild unserer <strong>Gesellschaft</strong> ist. Der Transformationsprozess<br />
ist dabei im Wesentlichen gekennzeichnet durch<br />
einen Prozess der Ökonomisierung. Die Gegenwelt Sport wird<br />
zu einer Teilwelt des Wirtschaftssystems moderner <strong>Gesellschaft</strong>en.<br />
Aus organisatorischer Sicht lässt sich dies vor allem<br />
in den Vereinen erkennen, die die Basis des gemeinsamen<br />
Sportsystems darstellen. Immer mehr Vereine befinden sich<br />
dabei in einem Transformationsprozess hin zum Wirtschaftsunternehmen.<br />
Von Vereinen wird erwartet, dass sie ihre<br />
Strukturen der Wirtschaft anpassen, Managementprozesse<br />
sind gefragt, Manager haben Vereine zu führen, aus ehrenamtlicher<br />
Arbeit wird hauptamtliche Arbeit, Professionalisierung<br />
wird gefordert, Wachstum ist angesagt, obgleich es vor<br />
dem Hintergrund der angestammten Logik einer freiwilligen<br />
Vereinigung hierfür keine Notwendigkeit gibt. Ein Transformationsprozess<br />
von großer Tragweite kann auch unter den<br />
Athleten beobachtet werden. Immer mehr kommt es zu einer<br />
Totalisierung der Höchstleistungen. Man muss sich ganz der<br />
Sache widmen, andere Tätigkeiten neben dem Hochleistungssport<br />
verbieten sich. Doppelkarrieren haben allenfalls nur<br />
noch bei Randsportarten ihre Möglichkeiten, ansonsten sind<br />
die sportlichen Höchstleistungen in den einzelnen Sportarten<br />
nur noch durch eine volle Professionalität zu erreichen. Oft<br />
sind 60 und mehr Stunden Training gefordert, sieben Tage die<br />
Woche ist der Athlet fokussiert auf seine sportliche Höchstleistung.<br />
Eine gute Ausbildung in der Schule ist nur noch<br />
bedingt möglich, eine berufliche Karriere neben einer sportlichen<br />
Karriere verbietet sich. Betrachten wir die Zusammensetzung<br />
von Olympiamannschaften, so müssen wir erkennen,<br />
dass jene Athleten, die neben ihrer Rolle als Hochleistungssportler<br />
noch andere Rollen mit vergleichbarer Intensität<br />
erfüllen, die Ausnahme der Regel darstellen. Fast sämtliche<br />
Athleten einer Olympiamannschaft sind heute Angehörige<br />
der Bundeswehr oder des Bundesgrenzschutzes oder der<br />
Polizei, viele sind von ihrer Arbeit völlig freigestellt. Nur noch<br />
eine kleine Minderheit meistert die sogenannte Doppelkarriere.<br />
Zu diesem Totalisierungsprozess gehört auch die kontinuierliche<br />
Steigerung der Risiken, die die Ausübung des Hochleistungssports<br />
mit sich bringt. Diese Risiken hat der Athlet<br />
nahezu alleine zu tragen. Von einer sozialen Absicherung<br />
sportlicher Karrieren sind die modernen Hochleistungssportsysteme<br />
weiter entfernt denn je.<br />
Deshalb kann es nicht überraschen, dass der Transformationsprozess<br />
vom Gegenbild zum Abbild auch in moralischer<br />
Hinsicht zu beobachten ist. Angesichts der ökonomischen<br />
Bedeutungssteigerung des Hochleistungssports kommt es zu<br />
einem moralischen Verfall, Betrug wird immer wahrscheinlicher,<br />
Athleten befinden sich immer häufiger in der Falle des<br />
Hochleistungssports. Mitmachen bedeutet bereit sein zum<br />
Betrug, wer dazu nicht bereit ist, ist zur Zweitklassigkeit<br />
verurteilt oder hat seine Karriere zu beenden. Betrug zeigt<br />
dabei alle denkbaren Varianten. Er reicht von der Ergebnismanipulation<br />
zur Leistungsmanipulation des einzelnen Athleten<br />
bis hin zum Betrug bei Wahlhandlungen zu den Führungsgre-<br />
mien der einzelnen Sportarten. Gewalt wird zum nahezu<br />
selbstverständlichen Merkmal des modernen Sports. Sie wird<br />
von Athleten ebenso ausgeübt wie von den Zuschauern. Sie<br />
scheint in der Natur der Sache zu liegen, zumindest wird sie<br />
immer mehr als eine Selbstverständlichkeit hingenommen,<br />
gegen die wirksame Maßnahmen nicht wahrscheinlich sind.<br />
Die sportliche Höchstleistung wird dabei mit enormer gesellschaftlicher<br />
Bedeutung aufgeladen. Sportliche Höchstleistungen<br />
erzeugen höchste Emotionen, haben einen außergewöhnlich<br />
hohen Unterhaltungswert und ermöglichen für alle<br />
Beteiligten außergewöhnlich hohe Gewinne. Der Hochleistungssport<br />
ist dabei bestens anschlussfähig für die Massenmedien,<br />
für die Wirtschaft und die Politik. Immer mehr Athleten<br />
sind dabei bereit, alles zu investieren, was den sportlichen<br />
Erfolg sichern könnte. Das Ideal der Unversehrtheit des eigenen<br />
Körpers wird dabei über Bord geworfen, die eigene<br />
Gesundheit wird im vollen Bewusstsein der Gefahren, die der<br />
Hochleistungssport in sich birgt, in Frage gestellt. Schmerzen<br />
werden wider der Natur des eigenen Körpers gedämmt,<br />
Medikamente werden zur Leistungssteigerung genutzt, wohlwissend,<br />
dass sie eine Gefährdung der eigenen Gesundheit<br />
bedeuten können. Die körperliche Unversehrtheit des Gegners<br />
wird in Frage gestellt, wenn damit der eigene ökonomische<br />
Nutzen gesichert werden kann. Längst ist bei diesem Transformationsprozess<br />
des Sports zu erkennen, dass er sich genau<br />
jene Merkmale zu Eigen macht, die auch in der übrigen<br />
<strong>Gesellschaft</strong> zu finden sind. Wie in der Wirtschaft und wie in<br />
der Politik ist nun Korruption im Sport anzutreffen, wie in<br />
Wirtschaft und Politik finden Machtauseinandersetzungen in<br />
den Organisationen des Sports statt. Und das, was viele<br />
Funktionäre des Sports als Verteidigungsritual verwenden,<br />
wenn sie gefordert sind, wird zur gesellschaftlichen Realität:<br />
Der Sport ist nicht besser als die <strong>Gesellschaft</strong>, und er kann<br />
gewiss nicht Probleme der <strong>Gesellschaft</strong> lösen, wenn er die<br />
gleichen Verfehlungen aufweist, wie sie auch in der <strong>Gesellschaft</strong><br />
anzutreffen sind. Der Sport ist nicht mehr Gegenwelt,<br />
er ist Abbild der <strong>Gesellschaft</strong>. Seinen Siegeszug hat er seinem<br />
eigenen Werteverfall zu verdanken. Betrug, Korruption, Manipulation<br />
und all die sonstigen zu beklagenden Verfehlungen<br />
sind Teile eines kontinuierlichen Skandals, der die Unterhaltungsfunktion<br />
des Sports eher zu steigern weiß, als dass er<br />
sie in Frage stellen könnte. Moralische Appelle müssen dabei<br />
ebenso vergeblich sein, wie sie in der <strong>Gesellschaft</strong> vergeblich<br />
sind, und angesichts der vielen Verfehlungen in der <strong>Gesellschaft</strong><br />
hat auch der Sport keinen besonderen Legitimationszwang.<br />
Es gelingt ihm besser denn je, sich als wichtigen Teil<br />
der <strong>Gesellschaft</strong> auszuweiten. Angesichts dieses aufgezeigten<br />
Transformationsprozesses ist es höchst unwahrscheinlich,<br />
dass aus dem System des Sports heraus eine Rückbesinnung<br />
auf den Gegenweltcharakter des Sports erfolgen könnte. Der<br />
Sport in seinem Verhältnis zur Wirtschaft, zur Politik und zu<br />
den Massenmedien befindet sich in einer Win-Win Situation,<br />
deren Fortschreibung von allen gewünscht ist. Fatal ist dabei<br />
lediglich, dass dies auch dann der Fall ist, wenn dabei die<br />
Moral auf der Strecke bleibt.<br />
21