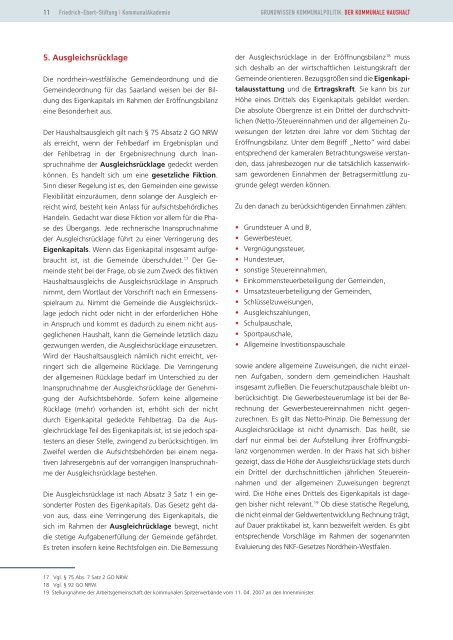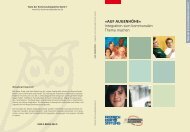GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11 Friedrich-Ebert-Stiftung | KommunalAkademie<br />
<strong>5.</strong> Ausgleichsrücklage<br />
Die nordrhein-westfälische Gemeindeordnung und die<br />
Gemeindeordnung für das Saarland weisen bei der Bildung<br />
des Eigenkapitals im Rahmen der Eröffnungsbilanz<br />
eine Besonderheit aus.<br />
<strong>Der</strong> <strong>Haushalt</strong>sausgleich gilt nach § 75 Absatz 2 GO NRW<br />
als erreicht, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und<br />
der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme<br />
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden<br />
können. Es handelt sich um eine gesetzliche Fiktion.<br />
Sinn dieser Regelung ist es, den Gemeinden eine gewisse<br />
Flexibilität einzuräumen, denn solange der Ausgleich erreicht<br />
wird, besteht kein Anlass für aufsichtsbehördliches<br />
Handeln. Gedacht war diese Fiktion vor allem für die Phase<br />
des Übergangs. Jede rechnerische Inanspruchnahme<br />
der Ausgleichsrücklage führt zu einer Verringerung des<br />
Eigenkapitals. Wenn das Eigenkapital insgesamt aufgebraucht<br />
ist, ist die Gemeinde überschuldet. 17 <strong>Der</strong> Gemeinde<br />
steht bei der Frage, ob sie zum Zweck des fi ktiven<br />
<strong>Haushalt</strong>sausgleichs die Ausgleichsrücklage in Anspruch<br />
nimmt, dem Wortlaut der Vorschrift nach ein Ermessensspielraum<br />
zu. Nimmt die Gemeinde die Ausgleichsrücklage<br />
jedoch nicht oder nicht in der erforderlichen Höhe<br />
in Anspruch und kommt es dadurch zu einem nicht ausgeglichenen<br />
<strong>Haushalt</strong>, kann die Gemeinde letztlich dazu<br />
gezwungen werden, die Ausgleichsrücklage einzusetzen.<br />
Wird der <strong>Haushalt</strong>sausgleich nämlich nicht erreicht, verringert<br />
sich die allgemeine Rücklage. Die Verringerung<br />
der allgemeinen Rücklage bedarf im Unterschied zu der<br />
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der Genehmigung<br />
der Aufsichtsbehörde. Sofern keine allgemeine<br />
Rücklage (mehr) vorhanden ist, erhöht sich der nicht<br />
durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag. Da die Ausgleichrücklage<br />
Teil des Eigenkapitals ist, ist sie jedoch spätestens<br />
an dieser Stelle, zwingend zu berücksichtigen. Im<br />
Zweifel werden die Aufsichtsbehörden bei einem negativen<br />
Jahresergebnis auf der vorrangigen Inanspruchnahme<br />
der Ausgleichsrücklage bestehen.<br />
Die Ausgleichsrücklage ist nach Absatz 3 Satz 1 ein gesonderter<br />
Posten des Eigenkapitals. Das Gesetz geht davon<br />
aus, dass eine Verringerung des Eigenkapitals, die<br />
sich im Rahmen der Ausgleichrücklage bewegt, nicht<br />
die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gefährdet.<br />
Es treten insofern keine Rechtsfolgen ein. Die Bemessung<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong> <strong>KOMMUNALPOLITIK</strong>: DER KOMMUNALE HAUSHALT<br />
der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz18 muss<br />
sich deshalb an der wirtschaftlichen Leistungskraft der<br />
Gemeinde orientieren. Bezugsgrößen sind die Eigenkapitalausstattung<br />
und die Ertragskraft. Sie kann bis zur<br />
Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden.<br />
Die absolute Obergrenze ist ein Drittel der durchschnittlichen<br />
(Netto-)Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen<br />
der letzten drei Jahre vor dem Stichtag der<br />
Eröffnungsbilanz. Unter dem Begriff „Netto“ wird dabei<br />
entsprechend der kameralen Betrachtungsweise verstanden,<br />
dass jahresbezogen nur die tatsächlich kassenwirksam<br />
gewordenen Einnahmen der Betragsermittlung zugrunde<br />
gelegt werden können.<br />
Zu den danach zu berücksichtigenden Einnahmen zählen:<br />
Grundsteuer A und B,<br />
Gewerbesteuer,<br />
Vergnügungssteuer,<br />
Hundesteuer,<br />
sonstige Steuereinnahmen,<br />
Einkommensteuerbeteiligung der Gemeinden,<br />
Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinden,<br />
Schlüsselzuweisungen,<br />
Ausgleichszahlungen,<br />
Schulpauschale,<br />
Sportpauschale,<br />
Allgemeine Investitionspauschale<br />
17 Vgl. § 75 Abs. 7 Satz 2 GO NRW.<br />
18 Vgl. § 92 GO NRW.<br />
19 Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der <strong>kommunale</strong>n Spitzenverbände vom 11. 04. 2007 an den Innenminister.<br />
sowie andere allgemeine Zuweisungen, die nicht einzelnen<br />
Aufgaben, sondern dem gemeindlichen <strong>Haushalt</strong><br />
insgesamt zufl ießen. Die Feuerschutzpauschale bleibt unberücksichtigt.<br />
Die Gewerbesteuerumlage ist bei der Berechnung<br />
der Gewerbesteuereinnahmen nicht gegenzurechnen.<br />
Es gilt das Netto-Prinzip. Die Bemessung der<br />
Ausgleichsrücklage ist nicht dynamisch. Das heißt, sie<br />
darf nur einmal bei der Aufstellung ihrer Eröffnungsbilanz<br />
vorgenommen werden. In der Praxis hat sich bisher<br />
gezeigt, dass die Höhe der Ausgleichsrücklage stets durch<br />
ein Drittel der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen<br />
und der allgemeinen Zuweisungen begrenzt<br />
wird. Die Höhe eines Drittels des Eigenkapitals ist dagegen<br />
bisher nicht relevant. 19 Ob diese statische Regelung,<br />
die nicht einmal der Geldwertentwicklung Rechnung trägt,<br />
auf Dauer praktikabel ist, kann bezweifelt werden. Es gibt<br />
entsprechende Vorschläge im Rahmen der sogenannten<br />
Evaluierung des NKF-Gesetzes Nordrhein-Westfalen.