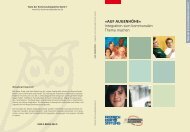GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
57 Friedrich-Ebert-Stiftung | KommunalAkademie<br />
In der Literatur existiert kein einheitlich defi nierter Kennzahlenbegriff.<br />
Dabei geht es unter anderem um die Frage,<br />
ob nur relative Zahlen oder auch absolute Zahlen in<br />
die jeweilige Kennzahlendefi nition einbezogen werden<br />
sollen. Eine absolute Zahl ist zum Beispiel die Anzahl der<br />
Fälle, eine relative Zahl beinhaltet den Aufwand pro Fall.<br />
Beides kann für die Steuerung von Bedeutung sein. Auf<br />
jeden Fall muss eine Kennzahl über einen zahlenmäßig<br />
erfassbaren Tatbestand informieren. Im <strong>kommunale</strong>n Bereich<br />
wird unter einer Kennzahl in der Regel die Relation<br />
von zwei absoluten Werten verstanden.<br />
In der NKF-Handreichung des Innenministeriums56 heißt<br />
es dazu:<br />
„Die gebildeten Ziele (Leistungs- und Finanzziele) sind<br />
u.a. zur Messung der Zielerreichung mit Leistungskennzahlen<br />
zu verbinden, d.h. erst sind die Ziele zu bestimmen,<br />
dann dazu die Leistungskennzahlen. Betriebswirtschaftlich<br />
sind Kennzahlen jene Zahlen, durch die quantitativ erfassbare<br />
Sachverhalte in konzentrierter Form wiedergegeben<br />
werden können. Sie setzen sich in der Regel aus zwei<br />
oder mehreren Grundzahlen zusammen und enthalten<br />
quantitative und aussagekräftige Informationen. Diese<br />
Kennzahlen nehmen unterschiedliche Funktionen wahr:<br />
– Sie stehen in engem Zusammenhang mit den vom Rat<br />
aufgestellten Zielvorgaben. Sie können häufi g bereits der<br />
Ermittlung und Beschreibung von Zielvorgaben dienen.<br />
– Sie dienen zur Kontrolle des Grades der Zielerreichung,<br />
insbesondere wenn mit der Zielbestimmung eine „Soll-<br />
Zahl“ verbunden wurde.<br />
– Sie haben eine Warnfunktion inne, weil durch sie Abweichungen<br />
ersichtlich und Analysen ermöglicht werden.“<br />
2. Informationelle Grundlagen von Zielen<br />
und Kennzahlen<br />
Gegen die Arbeit mit Zielen und Kennzahlen wird oftmals<br />
eingewandt, dass der Aufwand der Informationsbeschaffung<br />
sehr hoch sei. Deshalb ist es angebracht, zu dieser<br />
Fragestellung einige Hinweise zu geben. Wichtige vorhandene<br />
Datengrundlagen sind<br />
das in jeder Kommunalverwaltung vorhandene automatisierte<br />
Rechnungswesen sowie<br />
die statistischen Grunddaten des Landesamts für Statistik<br />
und Datenverarbeitung.<br />
56 NKF-Handreichung des Innenministeriums NRW, 4. Aufl ., Teil 3, § 12 GemHVO, Erlass II 1.1<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong> <strong>KOMMUNALPOLITIK</strong>: DER KOMMUNALE HAUSHALT<br />
Für beide Datenquellen entsteht kein zusätzlicher Erfassungsaufwand.<br />
Ferner sind die Fachbereiche und Produktverantwortlichen<br />
gehalten, im Rahmen der <strong>Haushalt</strong>splanaufstellung<br />
ihre Leistungsmengen zu planen<br />
und zu erfassen. Die Plan- und Ergebnisdaten stellen eine<br />
weitere wichtige Grundlage für die Ermittlung von Kennzahlen<br />
dar. Auch hier entsteht kein spezifi scher Mehraufwand.<br />
Die Auswertungen anderer Behörden (wie zum<br />
Beispiel die Verkehrsunfallstatistik der Polizei) können<br />
ebenfalls von Nutzen sein. Nur im Ausnahmefall sind zusätzliche<br />
Erhebungen (zum Beispiel Bürgerbefragungen<br />
oder Aufschreibungen am Arbeitsplatz) notwendig. Vor<br />
allem in kleineren Gemeinden, in denen eine Mitarbeiterin<br />
oder ein Mitarbeiter eine Reihe von Produkten bearbeitet,<br />
dürften Aufzeichnungen zumindest zeitweise<br />
unvermeidlich sein. Insbesondere im Bereich der wirkungsorientierten<br />
Steuerung wird man auch auf Informationen<br />
anderer Fachbereiche zurückgreifen. <strong>Der</strong> Auslastungsgrad<br />
kostenpfl ichtiger Parkierungseinrichtungen<br />
kann etwas über die Wirksamkeit der Überwachung des<br />
ruhenden Verkehrs aussagen. Die Entwicklung der Wahlbeteiligung<br />
bei Kommunalwahlen in Stadt- oder Wahlbezirken<br />
wird allgemein als Indikator für die Sozialstruktur<br />
angesehen.<br />
<strong>Der</strong> Informationsbeschaffungsaufwand hängt natürlich<br />
auch davon ab, wie oft die Kennzahl benötigt wird. Die<br />
produktorientierten Kennzahlen haben wegen ihrer Abhängigkeit<br />
vom <strong>Haushalt</strong>splan nur bei der Planaufstellung<br />
und bei der Erstellung des Jahresabschlusses eine direkte<br />
Steuerungsrelevanz. Anders verhält es sich selbstverständlich<br />
bei der unterjährigen Verwaltungssteuerung<br />
oder bei der Steuerung größerer Einzelprojekte. Hier<br />
kommt es auf eine möglichst zeitnahe und aktuelle Datenbasis<br />
an.<br />
Jede Verwaltung ist traditionell zu einem Großteil damit<br />
beschäftigt, Berichte zu erstellen – textlastige Verwaltungsberichte,<br />
die niemand liest, Berichte an die Politik,<br />
in denen die entscheidende Information im vorletzten<br />
Absatz steht, Berichte an Vorgesetzte und Aufsichtsbehörden,<br />
die auf Anfrage eigens erstellt werden und Berichte<br />
für andere Behörden, die dort in den Akten verschwinden.<br />
Die Ressourcen, die durch diese Art der<br />
Aufbereitung des Verwaltungshandelns gebunden werden,<br />
sind beträchtlich. Ein adressatengerechtes Ziele- und<br />
Kennzahlensystem kann hier sowohl die Qualität als auch<br />
die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns deutlich<br />
verbessern.