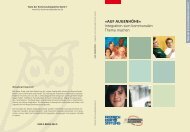GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
GRUNDWISSEN KOMMUNALPOLITIK 5. Der kommunale Haushalt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
41 Friedrich-Ebert-Stiftung | KommunalAkademie<br />
Zinsänderungen zu minimieren. Bei den Auszahlungen<br />
für Investitionen soll die Gemeinde eine Nettoneuverschuldung<br />
vermeiden.<br />
Sie soll bei Investitionen berücksichtigen, dass damit in<br />
der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in<br />
Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen,<br />
die den <strong>Haushalt</strong>sausgleich erschweren.<br />
Bilanz<br />
Nach § 95 Abs. 1 S. 3 GO i. V. m. § 37 Abs. 1 S. 2 Nr. 4<br />
GemHVO ist die Gemeinde verpfl ichtet, im Rahmen<br />
des Jahresabschlusses eine Bilanz zu erstellen. Gemeindeordnung<br />
und Gemeindehaushaltsverordnung<br />
sehen keine Planbilanz in Verbindung mit der Aufstellung<br />
des <strong>Haushalt</strong>es vor. Sofern die Gemeinde auf<br />
Grund von § 75 Abs. 5 GO zur Aufstellung eines HSK<br />
verpfl ichtet ist, können die erforderlichen Maßnahmen<br />
aus dem Jahresabschluss, der die Pfl icht zur Aufstellung<br />
des HSK ausgelöst hat, entwickelt werden. Aber<br />
auch im Regelfall der Aufstellung und Fortführung<br />
eines HSK in Verbindung mit der Aufstellung des <strong>Haushalt</strong>s<br />
kann und soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung<br />
der Bilanzstruktur enthalten. Dabei sind von der<br />
Gemeinde insbesondere folgende Ziele anzustreben:<br />
Vorrangiges Ziel muss die Rückführung der Kredite<br />
zur Liquiditätssicherung sein.<br />
Daneben sollte die Rückführung der längerfristigen<br />
Verbindlichkeiten angestrebt werden, vor allem<br />
dann, wenn die Verbindlichkeiten im inter<strong>kommunale</strong>n<br />
Vergleich überdurchschnittlich sind.<br />
Außerdem sollte die Gemeinde eine Optimierung<br />
der Struktur des Anlagevermögens anstreben und<br />
zu diesem Zweck ihr Vermögen daraufhin untersuchen,<br />
inwieweit es für öffentliche Zwecke noch benötigt<br />
wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Vermögensgegenstände<br />
in der Regel nur zu ihrem vollen<br />
Wert veräußert werden dürfen (§ 90 Abs. 1 GO).<br />
Mit der Vermögensveräußerung ist vorrangig das<br />
Ziel zu verfolgen, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen<br />
zu minimieren. Ihre beabsichtigte Verwendung<br />
ist deshalb im HSK gesondert darzulegen.<br />
HSK-Kommunen haben verstärkt für eine Optimierung<br />
des Forderungsmanagements, insbesondere<br />
eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen,<br />
Sorge zu tragen (§ 23 Abs. 3 GemHVO).<br />
Grundsätzlich führen Fehlbeträge zu einer Reduzie-<br />
38 Vgl. Urteil des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13. 8. 1996, VerfGH 23/94.<br />
<strong>GRUNDWISSEN</strong> <strong>KOMMUNALPOLITIK</strong>: DER KOMMUNALE HAUSHALT<br />
rung des Eigenkapitals und wirken sich damit negativ<br />
in der Bilanz aus. Im HSK sind alle Maßnahmen in<br />
Betracht zu ziehen, die zu einer Reduzierung des<br />
Fehlbetrags geeignet sind. Sollte allerdings der völlige<br />
Verbrauch des Eigenkapitals (§ 75 Abs. 7 GO,<br />
Überschuldung) bereits eingetreten sein, reicht es<br />
nicht mehr aus, dass die Gemeinde einen ausgeglichenen<br />
<strong>Haushalt</strong> anstrebt oder erreicht. Vielmehr<br />
muss die Gemeinde in diesem Fall die Erwirtschaftung<br />
von Überschüssen (durch eine noch stärkere<br />
Senkung von Aufwendungen und eine weitere<br />
Steigerung von Erträgen) einplanen, um wieder ein<br />
positives Eigenkapital zu erreichen sowie einen weiteren<br />
Eigenkapitalaufbau anzustreben.<br />
Im Mittelpunkt des Erlasses stehen also Aufwandsreduzierungen<br />
(zum Beispiel Personalabbau, Umorganisation,<br />
kritische Überprüfung – vornehmlich zuschussintensiver –<br />
gemeindlicher Dienstleistungen und Einrichtungen sowie<br />
Einsparungen jedweder Art im sächlichen Bereich, zum<br />
Beispiel im Gebäudebestand durch ein modernes Gebäudemanagement)<br />
sowie Ertragsverbesserungen durch eine<br />
größtmögliche Ausschöpfung der vorhandenen Möglichkeiten<br />
(zum Beispiel Erhöhung des Kostendeckungsgrades<br />
bei Gebühren und Beiträgen, gegebenenfalls Erhöhung<br />
gemeindlicher Abgaben und auch privatrechtlicher<br />
Entgelte).<br />
3. Genehmigung unter Bedingungen und<br />
Aufl agen<br />
Die Aufsichtsbehörde kann die Genehmigung des <strong>Haushalt</strong>ssicherungskonzepts<br />
unter Bedingungen und mit<br />
Aufl agen erteilen. Es handelt sich um Nebenbestimmungen,<br />
die nur ausgesprochen werden dürfen, wenn<br />
an sich die Voraussetzungen für eine Verweigerung der<br />
Genehmigung vorliegen. Bei der Auswahl der Nebenbestimmung<br />
hat die Kommunalaufsicht das Übermaßverbot<br />
zu beachten. Das heißt, dass die Maßnahme geeignet,<br />
erforderlich und verhältnismäßig sein muss. Reine<br />
Zweckmäßigkeitserwägungen sind unzulässig. 38 Nach<br />
dem Urteil des Verfassungsgerichts ist davon auszugehen,<br />
dass Nebenbestimmungen zu Genehmigungen von<br />
<strong>Haushalt</strong>ssicherungskonzepten nur insoweit zulässig sind,<br />
als sie nicht auf Zweckmäßigkeitserwägungen hinaus-