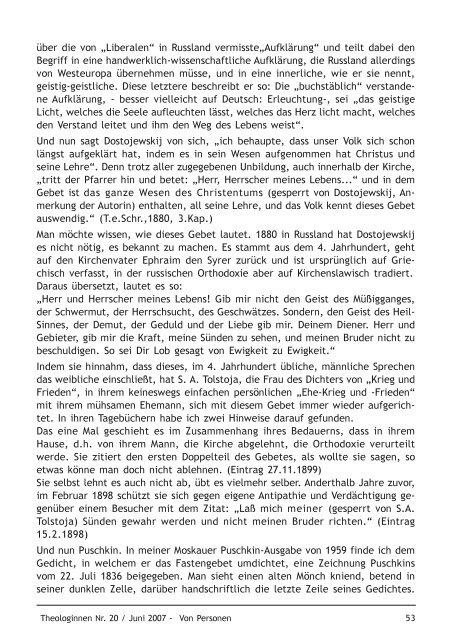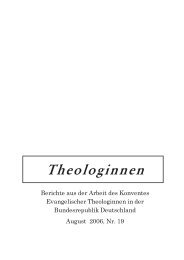2007 - Konvent Evangelischer Theologinnen
2007 - Konvent Evangelischer Theologinnen
2007 - Konvent Evangelischer Theologinnen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
über die von „Liberalen“ in Russland vermisste„Aufklärung“ und teilt dabei den<br />
Begriff in eine handwerklich-wissenschaftliche Aufklärung, die Russland allerdings<br />
von Westeuropa übernehmen müsse, und in eine innerliche, wie er sie nennt,<br />
geistig-geistliche. Diese letztere beschreibt er so: Die „buchstäblich“ verstandene<br />
Aufklärung, - besser vielleicht auf Deutsch: Erleuchtung-, sei „das geistige<br />
Licht, welches die Seele aufleuchten lässt, welches das Herz licht macht, welches<br />
den Verstand leitet und ihm den Weg des Lebens weist“.<br />
Und nun sagt Dostojewskij von sich, „ich behaupte, dass unser Volk sich schon<br />
längst aufgeklärt hat, indem es in sein Wesen aufgenommen hat Christus und<br />
seine Lehre“. Denn trotz aller zugegebenen Unbildung, auch innerhalb der Kirche,<br />
„tritt der Pfarrer hin und betet: „Herr, Herrscher meines Lebens...“ und in dem<br />
Gebet ist das ganze Wesen des Christentums (gesperrt von Dostojewskij, Anmerkung<br />
der Autorin) enthalten, all seine Lehre, und das Volk kennt dieses Gebet<br />
auswendig.“ (T.e.Schr.,1880, 3.Kap.)<br />
Man möchte wissen, wie dieses Gebet lautet. 1880 in Russland hat Dostojewskij<br />
es nicht nötig, es bekannt zu machen. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert, geht<br />
auf den Kirchenvater Ephraim den Syrer zurück und ist ursprünglich auf Griechisch<br />
verfasst, in der russischen Orthodoxie aber auf Kirchenslawisch tradiert.<br />
Daraus übersetzt, lautet es so:<br />
„Herr und Herrscher meines Lebens! Gib mir nicht den Geist des Müßigganges,<br />
der Schwermut, der Herrschsucht, des Geschwätzes. Sondern, den Geist des Heil-<br />
Sinnes, der Demut, der Geduld und der Liebe gib mir. Deinem Diener. Herr und<br />
Gebieter, gib mir die Kraft, meine Sünden zu sehen, und meinen Bruder nicht zu<br />
beschuldigen. So sei Dir Lob gesagt von Ewigkeit zu Ewigkeit.“<br />
Indem sie hinnahm, dass dieses, im 4. Jahrhundert übliche, männliche Sprechen<br />
das weibliche einschließt, hat S. A. Tolstoja, die Frau des Dichters von „Krieg und<br />
Frieden“, in ihrem keineswegs einfachen persönlichen „Ehe-Krieg und -Frieden“<br />
mit ihrem mühsamen Ehemann, sich mit diesem Gebet immer wieder aufgerichtet.<br />
In ihren Tagebüchern habe ich zwei Hinweise darauf gefunden.<br />
Das eine Mal geschieht es im Zusammenhang ihres Bedauerns, dass in ihrem<br />
Hause, d.h. von ihrem Mann, die Kirche abgelehnt, die Orthodoxie verurteilt<br />
werde. Sie zitiert den ersten Doppelteil des Gebetes, als wollte sie sagen, so<br />
etwas könne man doch nicht ablehnen. (Eintrag 27.11.1899)<br />
Sie selbst lehnt es auch nicht ab, übt es vielmehr selber. Anderthalb Jahre zuvor,<br />
im Februar 1898 schützt sie sich gegen eigene Antipathie und Verdächtigung gegenüber<br />
einem Besucher mit dem Zitat: „Laß mich meiner (gesperrt von S.A.<br />
Tolstoja) Sünden gewahr werden und nicht meinen Bruder richten.“ (Eintrag<br />
15.2.1898)<br />
Und nun Puschkin. In meiner Moskauer Puschkin-Ausgabe von 1959 finde ich dem<br />
Gedicht, in welchem er das Fastengebet umdichtet, eine Zeichnung Puschkins<br />
vom 22. Juli 1836 beigegeben. Man sieht einen alten Mönch kniend, betend in<br />
seiner dunklen Zelle, darüber handschriftlich die letzte Zeile seines Gedichtes.<br />
<strong>Theologinnen</strong> Nr. 20 / Juni <strong>2007</strong> - Von Personen<br />
53