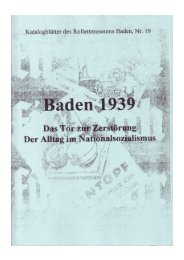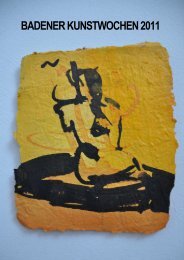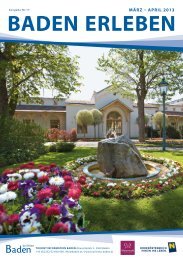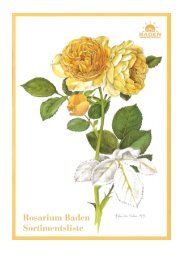Angelo Soliman. Ein Wiener Afrikaner im 18. Jahrhundert - Baden
Angelo Soliman. Ein Wiener Afrikaner im 18. Jahrhundert - Baden
Angelo Soliman. Ein Wiener Afrikaner im 18. Jahrhundert - Baden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
seine Großzügigkeit überschwenglich. Er ist wohl mit Joseph von Bender,<br />
dem späteren Paten seiner Tochter Josephine identisch.<br />
3.9 Anteilseigner am Bergbau<br />
Kobaltblüte und Kobaltglas-Ornamentfliese, 20. Jh.<br />
Privatbesitz<br />
Wie Alfred Weiß 2003 durch einen <strong>Ein</strong>trag <strong>im</strong> "Steirischen Gewerkenbuch"<br />
herausfand, erwarb der nun vermögende <strong>Sol<strong>im</strong>an</strong> 1766 zwei von<br />
insgesamt 128 Anteilen des Peter-und-Paul-Stollens in der Vetterspitze in<br />
den Schladminger Tauern. Dort baute man Kobalterz ab. Kobalt findet bis<br />
heute als Farbstoff u. a. in der Glasherstellung und Porzellanmalerei Verwendung.<br />
Erst durch die Weiterverarbeitung entsteht die intensiv blaue<br />
Tönung.<br />
3.10 <strong>Ein</strong> afrowiener Zeitgenosse: Der Charakterkopf<br />
Gipsbüste nach einer Moulage über Natur <strong>im</strong> Tod, vor 1798/05<br />
Rollettmuseum der Stadtgemeinde <strong>Baden</strong> bei Wien, Büste Nr. 41(?)<br />
Die würdevollen Züge dieses etwa siebzigjährigen <strong>Afrikaner</strong>s wurden kurz<br />
nach seinem Tod abgeformt. Dies dokumentieren die noch nicht eingesunkenen<br />
Augäpfel und die Authentizität der Lider, die man nur mit flüssigenm<br />
Gips bedecken kann, wenn die Person nicht mehr lebt. Auch diesen<br />
Zeitgenossen <strong>Sol<strong>im</strong>an</strong>s kann man sich als Vertrauten eines hochadeligen<br />
Arbeitgebers gut vorstellen.<br />
4. Heirat, Entlassung und Familie<br />
Mitglieder eines Hofstaates, Beamte, Militärs usw. benötigten bis 1918 eine<br />
Heiratserlaubnis von ihren Arbeitgebern und Vorgesetzten. Im Hochadel<br />
selbst hatte der Nachwuchs in der Regel die von den Eltern gemäß politischer<br />
und dynastischer Ziele ausgesuchten Ehepartner zu ehelichen. Dies<br />
traf auch für Kaiser Joseph II. zu, der sich als zweifacher Witwer schließlich<br />
weigerte, überhaupt noch einmal verheiratet zu werden. Eheschließungen<br />
ohne Eiverständnis der dafür vorgesehenen Instanzen führten in allen<br />
Ständen meist zur sozialen Ächtung. <strong>Ein</strong>e Kündigung sollte schließlich<br />
auch <strong>Sol<strong>im</strong>an</strong> erleben.<br />
30