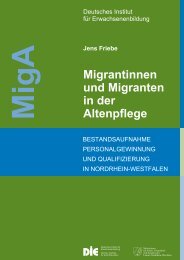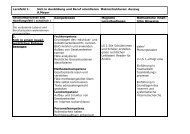Forschung für die Nachhaltigkeit - Fona
Forschung für die Nachhaltigkeit - Fona
Forschung für die Nachhaltigkeit - Fona
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10 Aktionsfeld 2 ZIELE, SCHWERPUNKTE UND ERSTE UMSETZUNGSPHASE IM ÜBERBLICK<br />
ca. 50% aller Gebäude saniert werden. Würden beispielsweise bis<br />
2010 13 Mio. Wohneinheiten nach der Energieeinsparverordnung<br />
saniert (30% aller Wohneinheiten), könnte <strong>die</strong> Emission von 13<br />
Mio. t CO 2<br />
vermieden werden. FuE-Beiträge müssen hier mit<br />
neuen ganzheitlichen und effizienten Konzepten ansetzen, <strong>die</strong><br />
unter Einbeziehung von KMU und regionalen Entscheidungsträgern<br />
eine optimale Kosten/Nutzen-Bilanz versprechen.<br />
Anpassungsstrategien und Risikomanagement: Parallel zu Emissionsvermeidung<br />
werden Strategien zur besseren Anpassung an<br />
das Klima erforscht, um heutige Schäden infolge von Wetterextremen<br />
einzugrenzen und Vorsorge für morgen zu treffen. Während<br />
der letzten Dekade stieg <strong>die</strong> Zahl der großen wetter- und klimabedingten<br />
Naturkatastrophen (ohne Erdbeben) verglichen mit den<br />
60er Jahren auf mehr als das Doppelte. Die volkswirtschaftlichen<br />
Schäden erhöhten sich inflationsbereinigt auf mehr als das Sechsfache,<br />
<strong>die</strong> versicherten Schäden sogar um den Faktor 13,5 (Münchener<br />
Rück 2004). Auch wenn der Beobachtungszeitraum noch<br />
nicht ausreicht, um ein wirklich repräsentatives Bild zu vermitteln,<br />
ist <strong>die</strong> bisherige Tendenz beunruhigend.<br />
Beispiele: Im Jahre 2003 starben in Westeuropa 20.000 Menschen<br />
an den Folgen des Hitzesommers (WHO), der Niedrigstand<br />
der Flüsse, wie z.B. am Rhein oder Po, führten zu Kühlwasserproblemen<br />
der Kraftwerke, der Binnenschifffahrt entstanden große<br />
Verluste, und in Portugal tobten <strong>die</strong> größten Waldbrände seit<br />
20 Jahren (volkswirtschaftliche Schäden in Süd-, Mittel- und Osteuropa<br />
insgesamt ca. 13 Mrd. US$). Im Jahre 2002 verursachte <strong>die</strong><br />
Flutkatastrophe an Elbe und Donau Schäden von insgesamt<br />
9,2 Mrd. € und forderte 15 Menschenleben. Im Jahre 1999 forderte<br />
der Orkan Lothar 80 Todesopfer, allein in Baden-Württemberg<br />
entstanden Sturmschäden in Höhe von 1 Mrd. €. Insgesamt wird<br />
eingeschätzt, dass für etwa 80% der weltweiten Wirtschaftstätigkeit<br />
Wetter und Klima eine Rolle spielen (Deutsche Bank, 2003).<br />
Vor <strong>die</strong>sem Hintergrund muss ein expertengestütztes Klassifikationssystem<br />
entwickelt werden, um <strong>die</strong> Vorhersage zu verbessern,<br />
Klima- und Wettersensibilität von Naturräumen und zivilisatorischen<br />
Standortfaktoren zu erfassen und vorsorgende Planungsgrundlagen<br />
für ein regionales Management zu entwickeln. Adressaten<br />
sind Unternehmen, für <strong>die</strong> Klima/Wetter hohe wirtschaftliche<br />
Relevanz besitzt, <strong>Forschung</strong>seinrichtungen, Akteure aus<br />
Verwaltung und Gesellschaft. Erwartet werden konkrete Beiträge<br />
zur Senkung der Anfälligkeit gegenüber Extremwetter und Klimawandel<br />
und <strong>die</strong> Nutzung daraus resultierender wirtschaftlicher<br />
Chancen. Klimaschutzstrategien sollen in den Jahren 2005-2008<br />
in Höhe von 35 Mio. € gefördert werden.<br />
und ökologischen Lebensraumqualität soll nach der nationalen<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>sstrategie bis zum Jahr 2020 ein Wert von<br />
30 ha/Tag erreicht werden. Schwerpunkte der Förderaktivitäten<br />
des BMBF werden regionale und überregionale Trendanalysen<br />
zur Raumentwicklung und deren Bewertung sein, ferner beispielhafte<br />
Modellkonzepte eines innovativen Flächenmanagements<br />
für ausgewählte Regionen und Flächentypen. Weiterhin<br />
liegt der Fokus auf Flächenrecycling, auf der Entwicklung neuer<br />
Maßstäbe für <strong>die</strong> Beurteilung von Bodenqualitäten und der<br />
Schutzbedürftigkeit ausgewählter Flächen und auf der Verbreitung<br />
von Wissen durch <strong>die</strong> Entwicklung neuer Informations- und<br />
Kommunikationsstrukturen. Ein möglicher Ansatz: Rein rechnerisch<br />
könnte <strong>die</strong> volle Nutzung der zur Zeit rd. 200.000 ha Brachflächen<br />
in Städten <strong>die</strong> derzeitige jährliche Inanspruchnahme von<br />
zusätzlichen 130 ha „grüner Wiese“ pro Tag für vier Jahre vollständig<br />
ersetzen. Es erscheint realistisch, dass das BMBF durch<br />
zielgerichtete Projektförderung den Kommunen dazu verhelfen<br />
kann, <strong>die</strong> Neuinanspruchnahme von Grünflächen um ca. 10 - 20%<br />
zu senken. Für Maßnahmen zu Flächenmanagement und Bodenschutz<br />
sind für <strong>die</strong> Jahre 2005-2008 <strong>Forschung</strong>sprojekte mit<br />
einem Volumen von 13 Mio. € geplant.<br />
Mega-urbane Agglomerationen: Das BMBF hat zum 1. Februar<br />
2004 eine neue Fördermaßnahme gestartet, <strong>die</strong> sich auf <strong>die</strong><br />
„Megastädte von morgen“ konzentriert. Es geht um schnell wachsende<br />
Millionenstädte, <strong>die</strong> in wenigen Jahren <strong>die</strong> Schwelle zur<br />
Megastadt überschreiten werden. Voraussichtlich bereits im Jahr<br />
2007 wird <strong>die</strong> Hälfte der Menschheit in Städten leben. Dieser Anteil<br />
wird bis 2030 auf etwa zwei Drittel ansteigen. Der weiter anhaltende<br />
Trend zur Verstädterung stellt eines der größten Probleme<br />
für eine globale nachhaltige Entwicklung dar. Denn hier werden<br />
in bisher nicht bekanntem Ausmaß Menschen-, Ressourcen,<br />
Waren- und Kapitalströme verdichtet und werden miteinander<br />
wechselwirken. Ziel der Fördermaßnahme ist es, Lösungsvorschläge<br />
und Strategien für eine nachhaltige Gestaltung der<br />
mega-urbanen Regionen der Zukunft zu erarbeiten und in Form<br />
von Pilotstu<strong>die</strong>n umzusetzen. Die Auswahl der Modellstädte wird<br />
bis 2006 erfolgt sein. Erste Gestaltungskonzepte sollen bis 2009<br />
vorliegen und in der anschließenden Umsetzungsphase erprobt<br />
Aktionsfeld 2:<br />
Nachhaltige Nutzungskonzepte für Regionen<br />
Urbane Räume: Flächenmanagement und mega-urbane<br />
Agglomerationen (s. Seite 22)<br />
Flächenmanagement: Nach dem Höchstwert des Jahres 2000<br />
wurden in Deutschland für Bau und Siedlungszwecke jeden Tag<br />
129 ha neu in Anspruch genommen. Zur Sicherung der sozialen