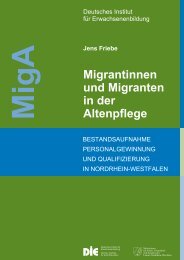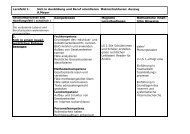Forschung für die Nachhaltigkeit - Fona
Forschung für die Nachhaltigkeit - Fona
Forschung für die Nachhaltigkeit - Fona
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
36 Aktionsfeld 4 FÖRDERZIELE IM DETAIL<br />
<strong>die</strong> Integration nicht-wissenschaftlichen Know-hows sowie eine<br />
verbesserte internationale Sichtbarkeit der deutschen Wirtschaftswissenschaften.<br />
E 4.3 Ökologische Modernisierung der<br />
Gesellschaft<br />
<strong>Forschung</strong> für gesellschaftliches Handeln in Richtung <strong>Nachhaltigkeit</strong><br />
soll Problemlösungswissen generieren und Akteure – Politik,<br />
Unternehmen, Konsumenten, Verbände, Kommunen, Bürger<br />
– handlungsfähiger machen. Sie soll <strong>die</strong> für das Handeln nötige<br />
Wissensbasis gemeinsam mit den Akteuren schaffen und damit<br />
zugleich einen Beitrag zur methodischen und theoretischen Stärkung<br />
inter- und transdisziplinärer <strong>Forschung</strong>sansätze leisten.<br />
Steuerungsinstrumente für eine nachhaltige<br />
Umweltpolitik<br />
Die gesellschaftliche Hinwendung zu einem dauerhaft umweltgerechten<br />
Umgang mit natürlichen Ressourcen hat in vielen<br />
Bereichen große Erfolge gebracht, <strong>die</strong> an der Reinheit der Luft,<br />
der Sauberkeit der Flüsse, den abnehmenden Einträgen von<br />
Schad- und Nährstoffen in Böden ablesbar sind. Nach Jahren der<br />
Bereitschaft, für eine funktionsfähige Umwelt Ressourcen bereit<br />
zu stellen, werden in letzter Zeit Fragen nach der Effizienz der<br />
eingesetzten Mittel und Instrumente und nach ihren sozialen<br />
Rückwirkungen lauter. Wie verhalten sich <strong>die</strong> angestrebten ökologischen<br />
Ziele zu sozialen und wirtschaftlichen Zielen? Welche<br />
Chancen für Umweltpolitik bieten sich in stagnierenden oder<br />
schrumpfenden Volkswirtschaften, in Zeiten der Globalisierung<br />
und des Umbruchs im Arbeitsmarkt?<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong>sforschung unterzieht politische, juristische<br />
und fiskalische Instrumente für den ökologischen Umbau der<br />
Gesellschaft einer interdisziplinären Analyse und entwickelt sie<br />
weiter. <strong>Nachhaltigkeit</strong>sforschung arbeitet neue Steuerungsstrategien<br />
vor dem Hintergrund aus, dass der Staat nicht alleiniger<br />
normsetzender Akteur ist, sondern in Konkurrenz bzw. subsidiärer<br />
Ergänzung zu Unternehmen, Verbänden und zivilgesellschaftlichen<br />
Gruppen mit ihren unterschiedlichen Interessenlagen<br />
und Einflussmöglichkeiten auftritt.<br />
Nachhaltige Konsummuster und Infrastrukturen<br />
Dem <strong>Nachhaltigkeit</strong>spostulat wirkt entgegen, wenn trotz steigender<br />
Anzahl umweltfreundlicher Produkte <strong>die</strong> Inanspruchnahme<br />
natürlicher Ressourcen und <strong>die</strong> Belastung der Umwelt in<br />
der Summe zunehmen. Denn häufig werden erreichte Fortschritte,<br />
etwa sparsamere Motoren, durch zunehmende Konsumansprüche<br />
(weitere Strecken, stärker motorisierte und schwerere<br />
Fahrzeuge) wieder kompensiert. Technischer Fortschritt zur<br />
Reduzierung der Umweltbelastung steht im Wettlauf mit neuen<br />
Bedürfnissen und weiter reichenden Ansprüchen, z.B. überall<br />
und jederzeit grundsätzlich jedes marktgängige Produkt erhalten<br />
zu können.<br />
Im Rahmen der sozial-ökologischen <strong>Forschung</strong> werden integrierte<br />
Lösungsstrategien für nachhaltige Konsummuster in ausgewählten<br />
Bedürfnisbereichen erarbeitet. Sie basieren auf Effizienz-<br />
und Suffizienzüberlegungen. Dabei steht aufgrund der<br />
Ernährung als Schlüssel zu nachhaltigem Konsum<br />
Die Diskussionen um BSE, Schweine- und Geflügelpest haben<br />
<strong>die</strong> frühere agrarpolitische Debatte um Grundwasserbelastungen<br />
abgelöst. Dabei weisen beide Stränge auf Nicht-<br />
<strong>Nachhaltigkeit</strong> in der Landwirtschaft hin. Mit der von der<br />
Bundesregierung eingeleiteten Agrarwende und der Reform<br />
der europäischen Agrarpolitik erhält <strong>die</strong> Landwirtschaft neue<br />
Rahmenbedingungen für einen Wandel hin zu einer nachhaltigen<br />
Entwicklung, <strong>die</strong> durch das Handeln der relevanten<br />
Akteure ausgefüllt werden müssen. Aus der Analyse der<br />
Bestimmungsgründe für <strong>die</strong> geringe Umstellungsbereitschaft<br />
der Agrarbranche auf den ökologischen Landbau identifizieren<br />
<strong>die</strong> Forschenden einerseits zusammen mit den<br />
Akteuren Möglichkeiten für unternehmerisches Verhalten<br />
und Kooperation entlang den Stufen der Wertschöpfungskette.<br />
Andererseits geht es um <strong>die</strong> Einpassung von nachhaltigen<br />
Ernährungsstrategien in <strong>die</strong> Alltagsroutinen des Verbrauchs.<br />
Die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist<br />
gekennzeichnet durch kleinere Haushalte, deren Mitglieder<br />
seltener kochen und sich stattdessen außer Haus ernähren,<br />
sowie den Erfolg halbfertiger Produkte (convenience food).<br />
Seit 2002 fördert das BMBF sozial-ökologische <strong>Forschung</strong>sprojekte,<br />
<strong>die</strong> sozial- und kommunikationswissenschaftliche<br />
Perspektiven mit betriebswirtschaftlichen, technischen und<br />
ernährungsökologischen Sichtweisen verknüpfen und integrierte<br />
Strategien für eine Ernährungs-, Agrar- und Konsumwende<br />
entwickeln. Hierbei wird auch gefragt, wie sich Präferenzen<br />
bilden und welche Legitimation der Staat zur Beeinflussung<br />
von Konsumenten hat. Denn Verbraucherinnen und<br />
Verbraucher haben eine erhebliche Macht – und Verantwortung<br />
– zur Entkopplung der Bedürfnisbefriedigung vom Ressourcenverbrauch.<br />
Ernährung ist mehr als ein rationaler oder physiologischer<br />
Vorgang. Sie ist zugleich sinnliches Erlebnis, Ausdruck des<br />
persönlichen Lebensstils und kultureller Ritus. Das BMBF fördert<br />
hierzu ein aktionsanalytisches Projekt, in dem <strong>die</strong>se<br />
„weichen Faktoren“ der Ernährung untersucht werden. Die<br />
beteiligten Ökonomen und Psychologen widersprechen Auffassungen<br />
aus der traditionellen Umweltdebatte, dass Konsumenten<br />
nur rational informiert und aufgeklärt werden müssten,<br />
damit sie ihr Verhalten ändern. Zusammen mit „slow food<br />
e.V.“ und anderen Verbänden, <strong>die</strong> sich einer langsameren,<br />
genüsslicheren Ernährung verschrieben haben, organisieren<br />
<strong>die</strong> Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu <strong>die</strong>sem<br />
Zweck „Ernährungsevents“, bei denen sie unterschiedliche<br />
Kommunikations- und Interaktionswege mit verschiedenen<br />
Zielgruppen erproben und wissenschaftlich auswerten.