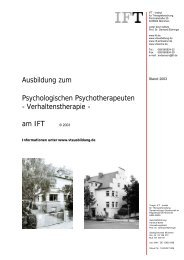IFT · Institut für Therapieforschung München München 2007 ...
IFT · Institut für Therapieforschung München München 2007 ...
IFT · Institut für Therapieforschung München München 2007 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9<br />
1 Hintergrund<br />
1.1 Einleitung<br />
Die bei weitem am häufigsten eingesetzte Therapie bei Opioidabhängigen ist die substitutionsgestützte<br />
Therapie mit den beiden Komponenten der Substitution mit einem geeigneten<br />
Substitutionsmittel und der psychosozialen Therapie (Havemann-Reinecke et al., 2006). Man<br />
schätzt, dass ca. 30 - 40% der Opiatabhängigen pro Jahr sich in einer Substitutionsbehandlung<br />
befinden (Wittchen, Apelt & Mühlig, 2005). Trotz des sehr breiten und vielfältigen Behandlungsangebots<br />
<strong>für</strong> Drogenabhängige von niedrigschwelligen Angeboten bis zur stationären<br />
Langzeittherapie gibt es eine Gruppe von Drogenabhängigen, die diese Angebote nicht<br />
in Anspruch nimmt und therapeutisch nur schwer erreichbar ist. Die Motive dieser Drogenabhängigen<br />
<strong>für</strong> ihre Therapiedistanziertheit sind wenig bekannt. Denkbar ist eine Vielzahl<br />
von Gründen, weshalb diese Gruppe das vielfältige Hilfeangebot in Deutschland nicht anspricht:<br />
Vorteile durch den drogenbezogenen Lebensstil, Be<strong>für</strong>chtungen der Manipulation<br />
und Verlust der Freiheit, Enttäuschung über frühere Behandlungserfahrungen, Rückzug nach<br />
Misserfolgen mit Behandlungsversuchen, geringes Selbstvertrauen in eigene Veränderungsmöglichkeiten<br />
u. a. Die Abgrenzung dieser Zielgruppe, die Abklärung der Motive und<br />
effektive Einflussfaktoren der Behandlungsmotivierung sind Fragestellungen in dem nachfolgenden<br />
kurz gefassten Literaturüberblick.<br />
1.2 Zusammenfassender Literaturüberblick<br />
Zielgruppe<br />
Zur Festlegung der Zielgruppe gibt es seit vielen Jahren Versuche, eine Gruppe von Drogenabhängigen<br />
abzugrenzen, die entweder keine Hilfeangebote annimmt bzw. gar nicht danach<br />
sucht und einer Gruppe, die trotz mehrerer Therapieversuche nicht erfolgreich behandelt<br />
werden konnte und die sich dann zurückzieht und <strong>für</strong> das Hilfesystem schwer erreichbar<br />
ist.<br />
Die Arbeitsgruppe CMA hat den Begriff Chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängige<br />
(CMA) definiert und dabei vier Kriteriumsbereiche unterschieden: 1. Konsumverhalten,<br />
2. Behandlungserfahrung, 3. gesundheitliche Situation und 4. soziale und rechtliche Situation.<br />
Ein Klient wurde dann der Gruppe CMA zugeordnet, wenn er in mindestens drei der vier<br />
Kriterienbereiche mindestens einen Punkt erreicht hat. Über die Einschlusskriterien, insbesondere<br />
hinsichtlich der Frage, welche Bedeutung der Behandlungserfahrung zukommt, gab<br />
es damals eine kontroverse Diskussion und auch heute ist kein breiter Konsens zu erwarten.<br />
Einflussfaktoren auf Behandlungsergebnisse<br />
Ein genereller Effekt sowohl der abstinenzorientierten als auch der substitutionsgestützten<br />
Behandlung erscheint nachgewiesen, auch wenn die Effekte insgesamt nicht als zufrieden<br />
stellend angesehen werden können (vgl. Küfner, 2001, Waal & Haga, 2003,<br />
Berglund et al., 2001, Küfner & Rösner, 2005). Bei der abstinenzorientierten Therapie kommt<br />
es zu sehr hohen Abbruchquoten, die in der Regel mit einem Therapiemisserfolg verbunden<br />
sind (vgl. Roch et al., 1992; Sonntag & Künzel, 2000) Bei der substitutionsgestützten Be-