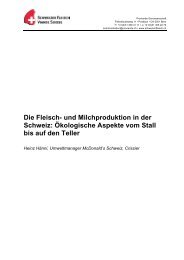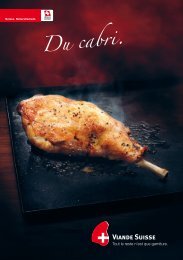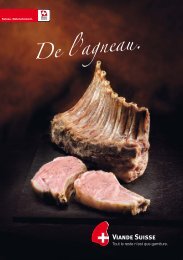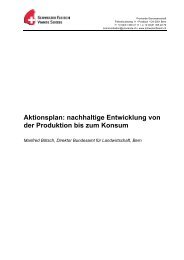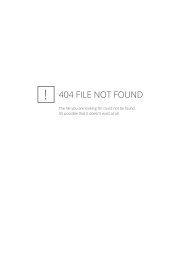UND LANDWIRTSCHAFT - Schweizer Fleisch
UND LANDWIRTSCHAFT - Schweizer Fleisch
UND LANDWIRTSCHAFT - Schweizer Fleisch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5.3 Tierwohlförderung<br />
Die Agrarpolitik versucht, das Tierwohl<br />
primär durch zwei Anreizmassnahmen zu<br />
fördern: Bei Stallneubauten über 20 %<br />
höhere Investitionskredite für besonders<br />
tierfreundliche Ställe (BTS), beispielsweise<br />
Freilaufställe für Kühe, sowie<br />
jährliche Direktzahlungen für Bauern, die<br />
sich verpflichten, die Vorschriften der<br />
Tierwohlprogramme Regelmässiger Auslauf<br />
ins Freie (RAUS) und Besonders tierfreundliche<br />
Stallhaltung (BTS) einzuhalten.<br />
Die Grundidee der ökologischen und<br />
der Tierwohldirektzahlungen – Förderung<br />
konkreter und gesellschaftlich erwünschter<br />
Leistungen mittels Beiträgen – hat sich<br />
auch bei BTS und RAUS als richtig erwiesen.<br />
Hier wurde tatsächlich bei mehreren<br />
der geförderten Tierkategorien etwas ausgelöst<br />
und somit Gesundheit und Wohlbefinden<br />
der Tiere verbessert.<br />
Das Tierwohl stellt nur teilweise eine<br />
marktfähige Leistung dar, die über das<br />
Schaffen von Labels und entsprechender<br />
Konsumentennachfrage abgegolten<br />
werden kann. Für viele der in der Landwirtschaft<br />
genutzten rund 25 Tierkategorien<br />
gibt es denn auch keine, respektive<br />
Entwicklung Tierwohl-Förderprogramme<br />
BTS und RAUS 1996 bis 2009<br />
CHF 180<br />
CHF 160<br />
CHF 140<br />
CHF 120<br />
CHF 100<br />
CHF 80<br />
CHF 60<br />
CHF 40<br />
CHF 29<br />
CHF 0<br />
144<br />
47<br />
lassen sich überhaupt keine Tierwohllabels<br />
schaffen, mit denen sich eine bessere<br />
Tierhaltung via Markt und Konsumentennachfrage<br />
fördern liesse. Das gilt etwa<br />
für alle Jung- und Aufzuchttiere, Muttersauen,<br />
Ziegen, Schafe und Pferde.<br />
Deshalb führte der Bund mit dem Direktzahlungssystem<br />
Mitte der 1990er-<br />
Jahre Förderprogramme für besonders<br />
tierfreundliche Haltungsformen ein. In<br />
Ergänzung zu den beschränkten Möglichkeiten<br />
des Marktes sollten sich Landwirte<br />
auf freiwilliger Basis an staatlichen Programmen<br />
zur Tierwohlförderung beteiligen.<br />
Nach übereinstimmender Meinung<br />
von Behörden, Bauern und Tierschützern<br />
wirken BTS und RAUS zielgenau durch<br />
konkrete und nachweisbare Tierwohlmehrleistungen,<br />
spezifiziert für jede der<br />
rund zwei Dutzend auf <strong>Schweizer</strong> Bauernhöfen<br />
gehaltenen Tierkategorien. Tierfreundliche<br />
Haltungsformen kosten mehr<br />
als lediglich gesetzeskonforme. Sie verursachen<br />
Mehrarbeit, erfordern zusätzliche<br />
Infrastruktur (Ausläufe, verhaltensgerechte<br />
Einrichtungen) und Unterhaltskosten<br />
(Einstreu zum Liegen statt kahle,<br />
harte Betonböden). Gleichzeitig werden<br />
wie etwa bei Freilandpoulets durch<br />
153<br />
50<br />
161 163<br />
RAUS Gesamte Beitragssumme/Jahr<br />
BTS Gesamte Beitragssumme/Jahr<br />
1996 2004 2006 2008 2009<br />
56<br />
60<br />
die Wahl entsprechender Rassen, welche<br />
langsamer wachsen und weniger <strong>Fleisch</strong><br />
ansetzen, die Einnahmen vermindert.<br />
BTS/RAUS haben zu nachweislichen<br />
Verbesserungen des Tierwohls und der<br />
Tiergesundheit geführt, wie dies beispielsweise<br />
Untersuchungen von BVET und<br />
BLW an Milchkühen oder Mastschweinen<br />
zeigen. Die grössten Effekte bezüglich<br />
Tierwohl und Tiergesundheit wurden<br />
stets auf jenen Betrieben gemessen, welche<br />
BTS und RAUS kombinieren. Die qualitativen<br />
Vorgaben der BTS- und RAUS-<br />
Vorschriften haben sich grösstenteils bewährt<br />
und gewährleisten ein akzeptables<br />
Tierwohl.<br />
Die Vorgaben verbessern in Teilbereichen<br />
auch die Produktequalität, die Lebensmittelsicherheit<br />
(BTS/RAUS-Mastschweinehaltungen<br />
weisen deutlich weniger<br />
antibiotikaresistente Keime auf)<br />
und die Tiergesundheit (z. B. weniger<br />
Hautschäden bei BTS/RAUS-Kühen und<br />
-Schweinen; tiefere Mortalitätsrate bei<br />
Freilandpoulets). Die mit RAUS geförderte<br />
Weidehaltung von Rindern, Kühen, Ziegen<br />
und Schafen verringert die Ammoniakemissionen<br />
und den CO2-Ausstoss.<br />
Indem sie einen Teil dieses Mehraufwands<br />
abdecken, bieten BTS- und RAUS-<br />
Beiträge den Bauern einen gewissen Anreiz,<br />
die gesellschaftlich erwünschte<br />
Mehrleistung für das Tierwohl zu erbringen.<br />
Ideale Voraussetzungen sind dabei<br />
motivierte Tierhalter, deren Betriebe<br />
gute bauliche Voraussetzungen für BTS/<br />
RAUS aufweisen (Stallsystem erfordert<br />
nur leichte Anpassungen, oder es ist ein<br />
Neu-/Umbau geplant) und die eine Tierkategorie,<br />
für deren Produkte ein Label im<br />
Detailhandel oder im Gastrokanal existiert,<br />
auf BTS/RAUS umstellen wollen. Die<br />
allermeisten Betriebe, die sich heute an<br />
BTS/RAUS beteiligen, dürften zwei oder<br />
gar alle drei dieser Voraussetzungen mitbringen.<br />
Für rund die Hälfte der Tierkategorien<br />
lassen sich aber keine Tierwohllabels und<br />
entsprechende marktgängige Produkte<br />
schaffen, sodass hier keine Synergien<br />
zwischen Markt und BTS/RAUS/Agrarpolitik<br />
spielen können. Der Umstellungsan-<br />
SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS<br />
27