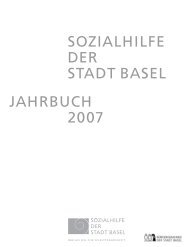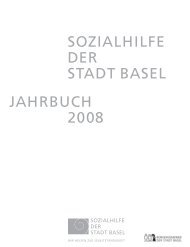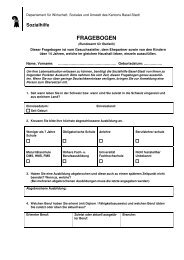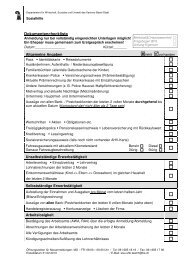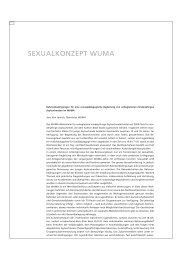Jahrbuch 2008 - Sozialhilfe - Kanton Basel-Stadt
Jahrbuch 2008 - Sozialhilfe - Kanton Basel-Stadt
Jahrbuch 2008 - Sozialhilfe - Kanton Basel-Stadt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
57<br />
sollten eine akzeptierende, transparente und konsequente Haltung in der Zusammenarbeit mit ihrer<br />
Kontaktperson erfahren. Grundsätzlich muss geklärt werden, ob ein ‹Nicht-Wollen› oder ein ‹Nicht-<br />
Können› die individuelle Entwicklung zur Selbstständigkeit verhindert.<br />
In der Fallführung muss in jedem Einzelfall definiert werden, welches Ziel (oder welche Ziele) im<br />
Prozess der <strong>Sozialhilfe</strong>unterstützung erreicht werden sollen. Nach einer umfassenden Anamnese<br />
der Problemsituation der Betroffenen werden (nach Bedarf mit zusätzlichen Assessments) weiterführende<br />
Erkenntnisse gemeinsam mit den Klientinnen oder Klienten in angepasste Handlungsstrategien<br />
umgesetzt und regelmässig begleitend überprüft. Das Entwickeln von Alternativen zu<br />
scheinbar gefestigten Handlungsmustern und das Aufzeigen und Üben kleiner Schritte zu erfolgversprechenden<br />
Perspektiven sind wesentliche Themen im Aktivierungs- und Mitwirkungsprozess.<br />
Neben dem konsequenten professionellen methodischen Handeln und der Verfolgung der allgemein<br />
anerkannten übergeordneten Zielsetzungen erfordert das Aktivierungsprinzip auch weiterführende<br />
generelle Projekte und Ideen auf verschiedenen Handlungsebenen. Zudem sind die kontinuierliche,<br />
periodische Überprüfung von Zielsetzungen und Massnahmen (Monitoring) sowie die<br />
systematische Analyse von Erfahrungswerten als Grundlage zu einer generellen Bedarfsplanung<br />
unumgänglich. Der gezielten, verbindlichen Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern im sozialen<br />
<strong>Basel</strong> und der optimalen Nutzung interner und externer Synergien muss zukünftig noch mehr Aufmerksamkeit<br />
gewidmet werden.<br />
Trotz der unumgänglichen Individualisierung sind aber gewisse Kategorisierungen für den Gesamtbetrieb<br />
der <strong>Sozialhilfe</strong> von Vorteil. Zu diesen zu differenzierenden Gruppen gehören insbesondere:<br />
• Menschen in gesundheitlich schwierigen Problemsituationen (psychisch, physisch)<br />
• Menschen mit Suchtproblematik<br />
• junge Erwachsene<br />
• Menschen mit Migrationsproblematik und besonderen kulturellen Bezugsfeldern<br />
• alleinerziehende Eltern<br />
• Menschen mit fehlender Wohnkompetenz<br />
• Menschen ohne soziale Beziehungen mit drohender sozialer Desintegration<br />
• Menschen mit diversen altersbedingten Problemsituationen<br />
• Menschen ohne Arbeit mit besonderen Bildungsdefiziten<br />
• Familiensysteme ohne Arbeitsleistungen<br />
• Menschen mit unklarer Arbeitsfähigkeit<br />
Die Analyse der Problemlagen im Einzelnen erfordert eine Entscheidung zu bestimmten Fallführungsstrategien.<br />
In jedem Einzelfall muss eine solche Strategie nachweisbar und nachvollziehbar<br />
sein, wobei individuell gleichzeitig auch mehrere Strategien verfolgt werden können. Auch Strategiewechsel<br />
aufgrund spezieller Vorkommnisse und Veränderungen sind je nach Bedarf angebracht.<br />
Basis dieser Fallstrategien ist in jedem Fall die konsequente Einforderung der Mitwirkung (Gegenleistung)<br />
der Klientinnen und Klienten. So umfassen einzelne Fallführungsstrategien beispielsweise:<br />
a) Bekämpfung von <strong>Sozialhilfe</strong>missbrauch (Hausbesuche, Präsenzkontrollen, Sanktionen,<br />
Leistungseinstellung)<br />
b) Rückkehrhilfe und Beratung<br />
c) Stabilisierung sozialer Situationen, Verhinderung von Desintegration (Vermittlung von Tagesstruktur,<br />
Vermittlung von gesundheitlichen Massnahmen, betreutes Wohnen, therapeutische<br />
externe Begleitung)<br />
d) Integration in den ersten Arbeitsmarkt (Arbeitsintegrationsmassnahmen, Bewerbungstraining,<br />
Sprachkurse, Weiterbildung)<br />
e) soziale und gesellschaftliche Integration (Beschäftigungsprogramme, Integrationskurse,<br />
Freizeitprogramme, Zugang zu Selbsthilfeorganisationen)<br />
f) Sicherung der Wohnsituation (Wohnbegleitung, soziale Wohnungsvermittlung)<br />
g) Sozialrente als Überbrückungshilfe<br />
h) Gesundheitliche Abklärungsmassnahmen (Therapievermittlung, Arztvermittlung,<br />
IV-Anmeldung)