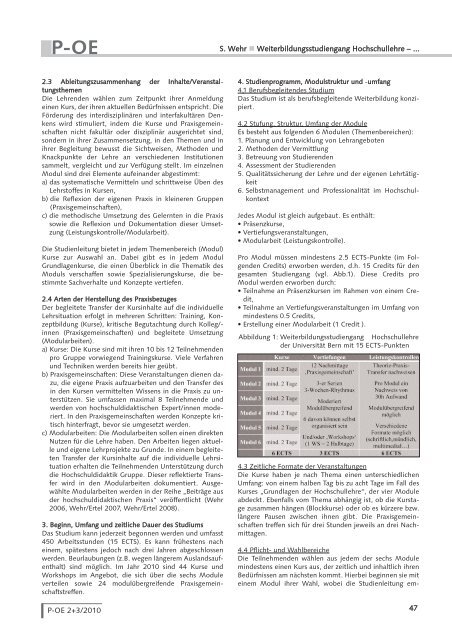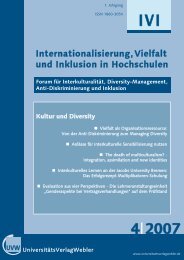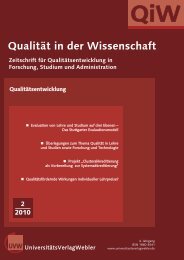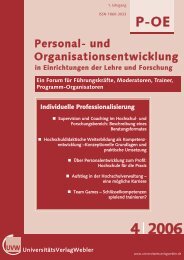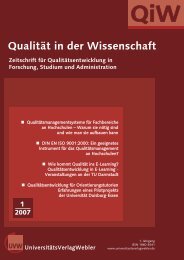P-OE - UniversitätsVerlagWebler
P-OE - UniversitätsVerlagWebler
P-OE - UniversitätsVerlagWebler
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
P-<strong>OE</strong><br />
S. Wehr • Weiterbildungsstudiengang Hochschullehre – ...<br />
2.3 Ableitungszusammenhang der Inhalte/Veranstaltungsthemen<br />
Die Lehrenden wählen zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung<br />
einen Kurs, der ihren aktuellen Bedürfnissen entspricht. Die<br />
Förderung des interdisziplinären und interfakultären Denkens<br />
wird stimuliert, indem die Kurse und Praxisgemeinschaften<br />
nicht fakultär oder disziplinär ausgerichtet sind,<br />
sondern in ihrer Zusammensetzung, in den Themen und in<br />
ihrer Begleitung bewusst die Sichtweisen, Methoden und<br />
Knackpunkte der Lehre an verschiedenen Institutionen<br />
sammelt, vergleicht und zur Verfügung stellt. Im einzelnen<br />
Modul sind drei Elemente aufeinander abgestimmt:<br />
a) das systematische Vermitteln und schrittweise Üben des<br />
Lehrstoffes in Kursen,<br />
b) die Reflexion der eigenen Praxis in kleineren Gruppen<br />
(Praxisgemeinschaften),<br />
c) die methodische Umsetzung des Gelernten in die Praxis<br />
sowie die Reflexion und Dokumentation dieser Umsetzung<br />
(Leistungskontrolle/Modularbeit).<br />
Die Studienleitung bietet in jedem Themenbereich (Modul)<br />
Kurse zur Auswahl an. Dabei gibt es in jedem Modul<br />
Grundlagenkurse, die einen Überblick in die Thematik des<br />
Moduls verschaffen sowie Spezialisierungskurse, die bestimmte<br />
Sachverhalte und Konzepte vertiefen.<br />
2.4 Arten der Herstellung des Praxisbezuges<br />
Der begleitete Transfer der Kursinhalte auf die individuelle<br />
Lehrsituation erfolgt in mehreren Schritten: Training, Konzeptbildung<br />
(Kurse), kritische Begutachtung durch Kolleg/-<br />
innen (Praxisgemeinschaften) und begleitete Umsetzung<br />
(Modularbeiten).<br />
a) Kurse: Die Kurse sind mit ihren 10 bis 12 Teilnehmenden<br />
pro Gruppe vorwiegend Trainingskurse. Viele Verfahren<br />
und Techniken werden bereits hier geübt.<br />
b) Praxisgemeinschaften: Diese Veranstaltungen dienen dazu,<br />
die eigene Praxis aufzuarbeiten und den Transfer des<br />
in den Kursen vermittelten Wissens in die Praxis zu unterstützen.<br />
Sie umfassen maximal 8 Teilnehmende und<br />
werden von hochschuldidaktischen Expert/innen moderiert.<br />
In den Praxisgemeinschaften werden Konzepte kritisch<br />
hinterfragt, bevor sie umgesetzt werden.<br />
c) Modularbeiten: Die Modularbeiten sollen einen direkten<br />
Nutzen für die Lehre haben. Den Arbeiten liegen aktuelle<br />
und eigene Lehrprojekte zu Grunde. In einem begleiteten<br />
Transfer der Kursinhalte auf die individuelle Lehrsituation<br />
erhalten die Teilnehmenden Unterstützung durch<br />
die Hochschuldidaktik Gruppe. Dieser reflektierte Transfer<br />
wird in den Modularbeiten dokumentiert. Ausgewählte<br />
Modularbeiten werden in der Reihe „Beiträge aus<br />
der hochschuldidaktischen Praxis“ veröffentlicht (Wehr<br />
2006, Wehr/Ertel 2007, Wehr/Ertel 2008).<br />
3. Beginn, Umfang und zeitliche Dauer des Studiums<br />
Das Studium kann jederzeit begonnen werden und umfasst<br />
450 Arbeitsstunden (15 ECTS). Es kann frühestens nach<br />
einem, spätestens jedoch nach drei Jahren abgeschlossen<br />
werden. Beurlaubungen (z.B. wegen längerem Auslandsaufenthalt)<br />
sind möglich. Im Jahr 2010 sind 44 Kurse und<br />
Workshops im Angebot, die sich über die sechs Module<br />
verteilen sowie 24 modulübergreifende Praxisgemeinschaftstreffen.<br />
P-<strong>OE</strong> 2+3/2010<br />
4. Studienprogramm, Modulstruktur und -umfang<br />
4.1 Berufsbegleitendes Studium<br />
Das Studium ist als berufsbegleitende Weiterbildung konzipiert.<br />
4.2 Stufung, Struktur, Umfang der Module<br />
Es besteht aus folgenden 6 Modulen (Themenbereichen):<br />
1. Planung und Entwicklung von Lehrangeboten<br />
2. Methoden der Vermittlung<br />
3. Betreuung von Studierenden<br />
4. Assessment der Studierenden<br />
5. Qualitätssicherung der Lehre und der eigenen Lehrtätigkeit<br />
6. Selbstmanagement und Professionalität im Hochschulkontext<br />
Jedes Modul ist gleich aufgebaut. Es enthält:<br />
• Präsenzkurse,<br />
• Vertiefungsveranstaltungen,<br />
• Modularbeit (Leistungskontrolle).<br />
Pro Modul müssen mindestens 2.5 ECTS-Punkte (im Folgenden<br />
Credits) erworben werden, d.h. 15 Credits für den<br />
gesamten Studiengang (vgl. Abb.1). Diese Credits pro<br />
Modul werden erworben durch:<br />
• Teilnahme an Präsenzkursen im Rahmen von einem Credit,<br />
• Teilnahme an Vertiefungsveranstaltungen im Umfang von<br />
mindestens 0.5 Credits,<br />
• Erstellung einer Modularbeit (1 Credit ).<br />
Abbildung 1: Weiterbildungsstudiengang Hochschullehre<br />
der Universität Bern mit 15 ECTS-Punkten<br />
4.3 Zeitliche Formate der Veranstaltungen<br />
Die Kurse haben je nach Thema einen unterschiedlichen<br />
Umfang: von einem halben Tag bis zu acht Tage im Fall des<br />
Kurses „Grundlagen der Hochschullehre“, der vier Module<br />
abdeckt. Ebenfalls vom Thema abhängig ist, ob die Kurstage<br />
zusammen hängen (Blockkurse) oder ob es kürzere bzw.<br />
längere Pausen zwischen ihnen gibt. Die Praxisgemeinschaften<br />
treffen sich für drei Stunden jeweils an drei Nachmittagen.<br />
4.4 Pflicht- und Wahlbereiche<br />
Die Teilnehmenden wählen aus jedem der sechs Module<br />
mindestens einen Kurs aus, der zeitlich und inhaltlich ihren<br />
Bedürfnissen am nächsten kommt. Hierbei beginnen sie mit<br />
einem Modul ihrer Wahl, wobei die Studienleitung em-<br />
47