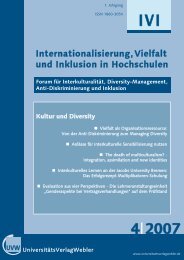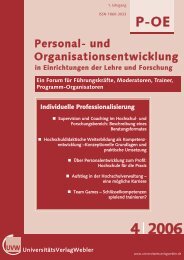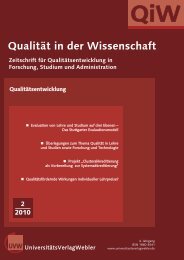P-OE - UniversitätsVerlagWebler
P-OE - UniversitätsVerlagWebler
P-OE - UniversitätsVerlagWebler
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
P-<strong>OE</strong><br />
W.-D. Webler • Schweizer Zertifikatsprogramme zum Auf- und Ausbau der Lehrkompetenz<br />
möglichkeiten von der Theorie in die Praxis geachtet sowie<br />
auf die Befähigung der Teilnehmenden zur selbstständigen<br />
Weiterentwicklung der eigenen Lehre. Eine Analyse beruflicher<br />
Anforderungen, die dem Profil zu Grunde liegen könnte,<br />
hat bei der Zürcher Fachhochschule besonders ausführlich<br />
stattgefunden: Der CAS HD basiert auf einem kompetenzorientierten<br />
Ansatz zur Bestimmung der notwendigen<br />
skills, knowledge and attitude, der auch als Ableitungszusammenhang<br />
der Inhalte ausgewiesen wird. Die Angebote<br />
der Universität Zürich weisen verschiedene Referenzpunkte<br />
beruflicher Anforderungen auf: Studentische Lernprozesse,<br />
die durch Lehre angestoßen und begleitet werden sollen.<br />
Außerdem Konzepte guter Lehre (orientiert an universitärer<br />
Bildung, Forschungsorientierung, Verknüpfung von Forschung<br />
und Lehre; daraus folgen notwendige Lehrkompetenzen<br />
(deren Erwerb, Aufbau, Modellierung). Alle Angebote<br />
der Universität Zürich sind bestimmten Grundüberlegungen<br />
als Ableitungszusammenhang der Inhalte verpflichtet.<br />
2.2.2 Vergleichende Bemerkungen<br />
Soweit anhand der Texte erkennbar, liegen allen Programmen<br />
sorgfältige, wenn auch unterschiedlich tief gehende<br />
Studien oder zumindest konzeptionelle Überlegungen zu<br />
Grunde. Es gibt darunter jedoch kein Programm, das sich<br />
sichtbar auf eine Analyse beruflicher Anforderungen an<br />
heutige Lehrkompetenz stützen würde, gerichtet auf Studierende<br />
in der schweizerischen Gesellschaft (und darüber<br />
hinaus), also auf einen größeren Ableitungszusammenhang.<br />
Hier wären in der weiteren Entwicklung tiefer gehende Reflexionen<br />
und Analysen denkbar, insbesondere in bildungstheoretischer<br />
Hinsicht. Die pauschale Beziehung auf die<br />
britischen SEDA-Grundlagen ist schon eine relativ gute<br />
Grundlage, reicht aber nicht. Sie entbindet die Verantwortlichen<br />
auch nicht der Notwendigkeit zu eigenen Analysen.<br />
Auch stellt sich die Frage nach dem Berufsbild, das hier als<br />
Basis genommen wird. Einige Programme scheinen sich –<br />
zumindest in ihrer Selbstdarstellung – stärker auf „classroom<br />
management” und dessen engeres Umfeld zu beschränken<br />
und ihre Schlussfolgerungen aus dortigen Beobachtungen<br />
abzuleiten. Die Universität Basel erweitert das<br />
der Ausbildung zu Grunde liegende Berufsbild explizit auf<br />
Tätigkeiten für solche Dozierenden, „die im Rahmen ihrer<br />
akademischen Karriere zunehmend Verantwortung für die<br />
Gesamtorganisation Universität und innerhalb der Selbstverwaltung<br />
der Universität neben der Lehrtätigkeit auch<br />
bildungs- und wissenschaftspolitische Aufgaben übernehmen”.<br />
Die Universitäten Bern und Zürich orientieren sich<br />
demgegenüber an den jeweiligen subjektiven Wahrnehmungen<br />
und daraus resultierenden Bedürfnissen der Betroffenen<br />
und deren Interpretation dessen, was zu professioneller<br />
Kompetenz benötigt wird. Hinter diesen Differenzen<br />
sind grundlegende Unterschiede des Bezugssystems zu vermuten,<br />
die weiter diskutiert werden sollten.<br />
P-<strong>OE</strong> 2+3/2010<br />
2.3 Profile der Programme<br />
2.3.1 Intendierte Lernergebnisse (learning outcomes)<br />
Den unterschiedlichen Berufsbildern als Leitvorstellung<br />
entsprechend werden auch die intendierten Lernergebnisse<br />
beschrieben. Neben dem Erwerb methodisch-didaktischer<br />
Kompetenzen wird im Programm der Universität Basel besonderer<br />
Wert darauf gelegt, zu lernen, wie Studierende<br />
stärker gefordert und gefördert werden können. Die Bildungsprozesse<br />
der Studierenden erhalten höheres Gewicht.<br />
Veranstaltungen befassen sich mit Beratung, Diversity, diagnostischen<br />
Kompetenzen, Demokratiebildung bis zum<br />
Mentoring von Nachwuchswissenschaftler/innen. In den<br />
Modulen können die Teilnehmenden ihr Rollenverständnis<br />
als Lehrende mit bildungspolitischen Gestaltungsaufgaben<br />
innerhalb der Organisation weiter entwickeln und entsprechende<br />
theoretische Modelle (bspw. Universitätsmodelle,<br />
Qualitätsmodelle, Didaktische Modelle, Führungsmodelle)<br />
kennen lernen. Damit sollen sie lernen, mit der neuen Rolle<br />
professionell und souverän umzugehen.<br />
An der Universität Bern sollen die Teilnehmenden als Ergebnis<br />
hochschuldidaktisch relevante Theorien, Konzepte<br />
und Methoden aus den Bereichen Planung und Entwicklung<br />
von Lernangeboten, Methoden des Erwerbs, Betreuung<br />
von Studierenden, Assessment der Studierenden, Qualitätssicherung<br />
der Lehre und eigener Lehrtätigkeit sowie<br />
Professionalität im Hochschulkontext kennen; diese Lehrtätigkeit<br />
modifizieren und in ihrem Berufsalltag anwenden<br />
können, den Kompetenzerwerb kritisch reflektieren und<br />
dokumentieren; Selbstmanagement und Professionalität in<br />
der Lehre und als Teammitglied erworben haben. Die jeweils<br />
zu erreichenden modulspezifischen Kompetenzen<br />
werden in Absprache mit der Betreuungsperson von den<br />
Teilnehmenden gewählt (!). Die Wahlmöglichkeiten richten<br />
sich nach den Vorgaben der SEDA; dort sind auch die jeweiligen<br />
learning outcomes formuliert.<br />
Die Teilnehmenden sollen an der Hochschule Luzern befähigt<br />
werden, ihre Lehrtätigkeit gemäss hochschuldidaktischer<br />
Qualitätsstandards zu gestalten. Diese Qualitätsstandards<br />
der Hochschule Luzern sind auf der Homepage der<br />
Fachstelle für Hochschuldidaktik nachzulesen. www.didakt<br />
ik.hslu.ch .<br />
Aufbauend auf lernpsychologischen und didaktischen Konzepten<br />
sowie der Reflexion der diesbezüglichen Alltagskonzepte<br />
folgt die Auseinandersetzung mit didaktischen<br />
Grundthemen: didaktische Vermittlungs- und Ermöglichungskonzepte<br />
und deren Umsetzung, Lernnachweise, Visualisierung.<br />
Dazu kommen rhetorische Kompetenzen und<br />
die Befähigung, die Beziehungsebene lernfördernd mitzugestalten<br />
(vgl. die Kursausschreibung auf www.didaktik.<br />
hslu.ch).<br />
An der Universität Luzern bestehen die intendierten Lernergebnisse<br />
in der Beherrschung didaktischer Grundfertigkeiten,<br />
der Reflexion der eigenen Lehrtätigkeit, Kenntnis der<br />
Grundlagen von Lehr-Lernprozessen an Universitäten; Transfer<br />
des Wissens in die eigene Lehrpraxis, Erweiterung des<br />
methodischen Repertoires (und entsprechende praktische<br />
Anwendung) sowie der Weiterentwicklung und Professionalisierung<br />
des didaktischen (Selbst-) Bewusstseins. Der Zertifikatslehrgang<br />
Hochschuldidaktik der Zürcher Fachhochschule<br />
beinhaltet die Grundausbildung zum Hochschuldozierenden<br />
im Bereich der Lehre. Schwerpunkte bilden die<br />
Entwicklung eines Rollenverständnisses als Hochschuldozierende/r<br />
mit kollegialer Kooperationsfähigkeit, Planungskompetenz,<br />
Leitungs- und Beratungskompetenz, theoriegeleitete,<br />
breite Methodenkompetenz, Praxistransfer in kollegialen<br />
Prozessen. Ziele der Universität Zürich können in<br />
einem handwerklich verstandenen „knowing how” liegen, in<br />
einem „knowing that” als Regelwissen oder einem „Knowing<br />
why” als Begründungswissen. Bei längeren Angeboten<br />
können mehrere Zieldimensionen verbunden werden.<br />
65