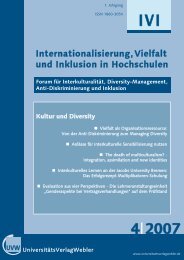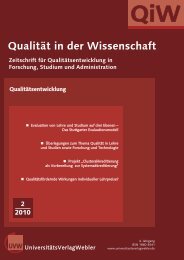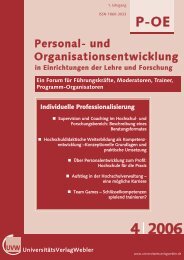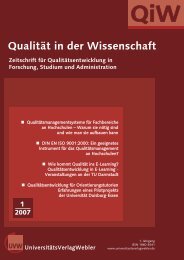P-OE - UniversitätsVerlagWebler
P-OE - UniversitätsVerlagWebler
P-OE - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
P-<strong>OE</strong><br />
W.-D. Webler • Schweizer Zertifikatsprogramme zum Auf- und Ausbau der Lehrkompetenz<br />
Forschung) zuständigen Mitglied der Hochschulleitung unterschrieben<br />
werden.<br />
10. Art der Qualitätssicherung? (Evaluation,<br />
wiss. Beirat o.ä.)<br />
Die Kurse des Sammelzertifikats Hochschuldidaktik der<br />
Universität Basel werden durch die Teilnehmenden mittels<br />
vorgegebener Fragebogen laufend schriftlich evaluiert. Ein<br />
Feedback durch die Referent/innen erfolgt nach jedem<br />
Kurs. Es finden regelmäßig auch Evaluationsgespräche mit<br />
den Referent/innen statt. Das Programm wird außerdem<br />
extern durch die SEDA evaluiert und akkreditiert. Die<br />
Leiterin des ESDU führt Visitationen einzelner Kurse durch.<br />
Alle 3 Jahre werden Fokusgruppeninterviews durchgeführt.<br />
Beim Dozierendenprogramm finden die gleichen qualitätssichernden<br />
Maßnahmen statt. Außerdem findet teilnehmende<br />
Beobachtung durch die verantwortliche Programmleiterin<br />
statt. An der Universität Bern ist eine Evaluation<br />
durch die Studiengangsleitung vorgesehen. Außerdem besteht<br />
eine Aufsicht durch die Programmleitung. Die Hochschule<br />
Luzern hat Qualitätsstandards entwickelt. Sie sind<br />
auf der Homepage der Fachstelle für Hochschuldidaktik<br />
nachzulesen. www.didaktik.hslu.ch . Außerdem findet eine<br />
jährliche Evaluation der einzelnen Module und des Gesamtkonzeptes<br />
statt. Die Evaluation erfolgt an der Universität<br />
Luzern durch die Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer<br />
im Anschluss an einzelne Kurstage und nach Abschluss<br />
des gesamten Moduls. Die Zürcher Fachhochschule<br />
betreibt ein anderes Qualitätsmanagement: Jedes Modul<br />
wird eine Woche nach Ende der Präsenzveranstaltung über<br />
das Internet von den Teilnehmenden evaluiert. Die Qualität<br />
wird auch an der Zufriedenheit der Teilnehmenden gemessen:<br />
Obwohl das Angebot bis jetzt nur über einen Webauftritt<br />
beworben wird, kommt durch Mund zu Mund Propaganda<br />
seit dem Start im Jahre 2006 jedes Jahr ein CAS mit<br />
ca. 20 Teilnehmenden zustande. Bis heute absolvierten<br />
gegen 100 Dozierende folgender Institutionen den CAS<br />
HD: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,<br />
Zürcher Hochschule der Künste, Pädagogische Hochschule<br />
Zürich, Hochschule für Technik Zürich, Hochschule für<br />
Wirtschaft Zürich, Fachhochschule Nordwestschweiz,<br />
Hochschule Luzern, Pädagogische Hochschule Graubünden,<br />
Berner Fachhochschule. Die Universität Zürich befindet<br />
sich in der eigenen Qualitätskontrolle im Verbund mit<br />
der ETH Zürich.<br />
Vergleichende Bemerkungen<br />
Alle diese Programme stehen unter einem hohen Legitimationsdruck.<br />
Daher sind regelmäßige Teilnahmebefragungen<br />
selbstverständlich. Allerdings sollten sie nicht unmittelbar<br />
am Ende eines Workshops stattfinden, da viele Ergebnisse<br />
erst Tage später klar werden, manchmal sogar erst viel später.<br />
Auswertungsgespräche mit den Moderator/innen sind<br />
schon weniger häufig, aber nicht weniger wichtig. Die Motivation<br />
und Einzelerwartungen der Teilnehmenden stehen<br />
manchmal in klarem Gegensatz zu den Zielen des Programms<br />
und des Einzelseminars; dann kommt es zu Konflikten<br />
(z.B. Teilnahmemotiv: schnelles Abholen von ein paar<br />
„Tricks und Tipps”, aber weitere Fragen nicht an sich heran<br />
kommen lassen). Solche Teilnehmer bewerten den Workshop<br />
u.U. sehr negativ.<br />
P-<strong>OE</strong> 2+3/2010<br />
11. Kosten des Studiums<br />
Die für die Teilnahme erhobenen Gebühren reichen von<br />
„Null” für Mitglieder der eigenen Hochschule (bei den Universitäten<br />
Bern und Luzern) stufenweise über 1.200 SFr.<br />
und 5.500/6.000 SFr. bis zu 10.800 SFr. (Universität Bern<br />
für Externe). Damit zeigt sich ein heterogenes Bild, wie<br />
auch in Deutschland. Einerseits gibt es Hochschulen, die<br />
die Kosten für ihre eigenen Lehrenden vollständig übernehmen<br />
und solche, in denen Kosten unterschiedslos für alle<br />
anfallen. Erkennbar sind Unterschiede in der Höhe bei vergleichbaren<br />
Leistungen. Da der Verfasser keinen Einblick in<br />
das Zustandekommen der Summen hat, sei ein kleiner Blick<br />
nach Deutschland geworfen: Mal wird sich dort einfach an<br />
den bereits bestehenden „Tarifen” anderer Hochschulen<br />
orientiert, ohne selbst Kosten zu rechnen. Mal wird die Belastbarkeit<br />
der potentiell Teilnehmenden geschätzt und mit<br />
deren Akzeptanzvorstellungen abgeglichen – also auch<br />
nicht kalkuliert. Dabei kommt in Deutschland 40-60 Euro<br />
pro Tag als Teilnahmebeitrag heraus. Zum Teil werden Externe<br />
höher belastet (auch wenn sie in Status und Einkommen<br />
vergleichbar sind). Mal besteht eine Hochschule auf<br />
einer Vollkostenrechnung (wie die Universität Bochum versucht<br />
hat), mal wird eine Hochschule (mit Unterstützung<br />
des dortigen Wissenschaftler-Personalrats) auf die Übernahme<br />
aller Kosten mit dem Hinweis verklagt, sie sei gesetzlich<br />
zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses<br />
(und zur Förderung ihres Personals) verpflichtet; also<br />
habe sie auch die Kosten zu tragen. Der Prozess ist noch anhängig.<br />
Zum Teil werden wohl die Kosten für auswärtige<br />
Referent/innen zugrunde gelegt, aber dann erfolgt eine<br />
Kostenteilung der Teilnehmenden mit der Hochschule,<br />
wobei diese den Hauptteil übernimmt. Bei dem vorliegenden<br />
schweizer Vergleich sind große Kostendifferenzen für<br />
Teilnehmende schon wegen der Unterschiede zwischen den<br />
Programmen im zeitlichen Volumen und den Arbeitsformen<br />
unvermeidlich. Aber über die darüber hinaus bestehenden<br />
Differenzen lohnt, noch einmal nach zu denken. In einem<br />
System, das von der Mobilität seiner Mitglieder lebt, also<br />
darauf angelegt ist, woanders ausgebildete Personen an die<br />
eigene Hochschule zu berufen bzw. selbst ausgebildete Personen<br />
abzugeben, ist es nicht systemkonform, Mitglieder<br />
anderer Hochschulen, die teilnehmen, finanziell zu bestrafen.<br />
Dieser Systemgedanke wird in Deutschland noch verschärft<br />
durch das sog. Hausberufungsverbot auf Professuren<br />
(im Regelfall kann eine Bewerbung aus dem eigenen Haus<br />
nicht berücksichtigt werden; damit wird Mobilität erzwungen).<br />
Genereller Eindruck also: Hier sollte noch einmal<br />
nachgerechnet werden.<br />
III. Resümee<br />
1. Erstausbildung oder Weiterbildung?<br />
Die Schweiz verfügt über ein reiches Angebot an Veranstaltungen<br />
zum Auf- und Ausbau der Lehrkompetenz. Auch<br />
außerhalb ganzer Zertifikatsprogramme gibt es zahlreiche<br />
Veranstaltungen. Viele Programme sind zunächst einmal –<br />
lokal gesehen – ein Erfolg. Sie sind im Zweifel immer gegen<br />
konkurrierende Investitionswünsche anderer Vorhaben<br />
(und innerhalb der Befürworter gegen sehr unterschiedliche<br />
71