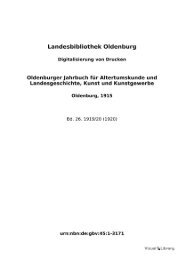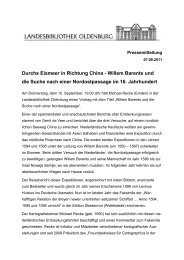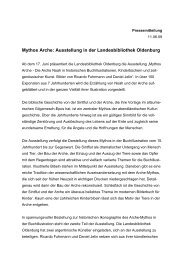M Maas - Mylius - der Landesbibliothek Oldenburg
M Maas - Mylius - der Landesbibliothek Oldenburg
M Maas - Mylius - der Landesbibliothek Oldenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1876 die Reifeprüfung ablegte. Von 1876<br />
bis 1880 studierte er zunächst sechs Semester<br />
Philosophie und Theologie an <strong>der</strong><br />
Akademie in Münster und anschließend<br />
zwei Semester praktische Theologie in<br />
Eichstätt, wo er am 18. 7. 1880 zum Priester<br />
geweiht wurde. Von 1880 bis 1884 war<br />
M. Schulvikar in Quakenbrück und danach<br />
bis 1901 Kaplan in <strong>Oldenburg</strong>, wo er<br />
auch als Religionslehrer am Gymnasium,<br />
als Seelsorger im Gefängnis und im Landeskrankenhaus<br />
Wehnen, als Rendant des<br />
Pius-Hospitals und als Präses des Gesellenvereins<br />
wirkte. Von 1901 bis 1922 war<br />
er Pfarrer in Friesoythe. In seiner Amtszeit<br />
wurden u. a. die Pfarrkirche im neogotischen<br />
Stil erbaut, das Krankenhaus erweitert<br />
und die höhere Mädchenschule gegründet.<br />
Die Stadt Friesoythe anerkannte<br />
später diese Verdienste durch die Verleihung<br />
<strong>der</strong> Ehrenbürgerschaft.<br />
Am 20. 6. 1922 wurde M. zum Bischöflichen<br />
Offizial in Vechta ernannt und am<br />
19. 7. 1922 in sein Amt eingeführt, gleichzeitig<br />
übernahm er den Vorsitz im Katholischen<br />
Oberschulkollegium. Seine erste<br />
Aufgabe war <strong>der</strong> Abschluß <strong>der</strong> bereits von<br />
seinem Vorgänger begonnenen Verhandlungen<br />
mit <strong>der</strong> oldenburgischen Staatsregierung<br />
über die Neuordnung <strong>der</strong> Beziehungen<br />
zwischen Kirche und Staat, die<br />
nach dem Inkrafttreten <strong>der</strong> neuen republikanischen<br />
Verfassungen des Reiches und<br />
des Freistaats <strong>Oldenburg</strong> notwendig geworden<br />
war. Zwar war schon 1921 auf dem<br />
Meyer<br />
459<br />
Verordnungswege eine weitgehende Befreiung<br />
<strong>der</strong> katholischen Kirche von <strong>der</strong><br />
staatlichen Aufsicht erfolgt, doch hatte die<br />
oldenburgische Regierung eine gesetzliche<br />
Regelung hinausgezögert, weil sie entsprechende<br />
Schritte <strong>der</strong> größeren Län<strong>der</strong>,<br />
insbeson<strong>der</strong>e Preußens, abwarten wollte.<br />
Durch das Gesetz vom 14. 4. 1924, das den<br />
irreführenden Titel „betreffend die Berechtigung<br />
<strong>der</strong> katholischen Kirche zur Erhebung<br />
von Steuern" trägt, wurde die<br />
Rechtsstellung <strong>der</strong> Kirche in Übereinstimmung<br />
mit dem neuen Verfassungsrecht geregelt.<br />
Die Kirche wurde von <strong>der</strong> bisherigen<br />
staatlichen Aufsicht befreit und erlangte<br />
als Körperschaft des öffentlichen<br />
Rechts die volle Selbständigkeit und die<br />
Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten.<br />
Diesem Gesetz folgten die von dem Offizial<br />
erlassene „Kirchengemeindeordnung<br />
für den oldenburgischen Teil <strong>der</strong> Diözese<br />
Münster" vom 8. 6. 1924 und die Wahlordnung<br />
vom 15. 7. 1924 für die Kirchenaus-<br />
schußwahl. Die Besserstellung <strong>der</strong> katholischen<br />
Kirche und <strong>der</strong> politisch-parlamentarische<br />
Einfluß, den die Südoldenburger<br />
Zentrumsabgeordneten in <strong>der</strong> Weimarer<br />
Zeit gewannen, verstärkten die Anhänglichkeit<br />
<strong>der</strong> katholischen Bevölkerung an<br />
<strong>Oldenburg</strong>. Als 1927/28 im Zusammenhang<br />
mit den Verhandlungen über das<br />
preußische Konkordat die Kurie den<br />
<strong>Oldenburg</strong>er Anteil <strong>der</strong> Diözese Münster<br />
dem Bistum Osnabrück zuteilen wollte,<br />
wies M. auf die beson<strong>der</strong>s günstige staats-<br />
kirchenrechtliche Stellung des Offizialatsbezirks<br />
hin und sprach sich für den Verbleib<br />
bei <strong>Oldenburg</strong> aus. Dagegen gelang<br />
es M. in <strong>der</strong> Endphase seiner Amtszeit<br />
nicht, die Aufhebung des Katholischen<br />
Oberschulkollegiums zu verhin<strong>der</strong>n. Um<br />
den Einfluß <strong>der</strong> Kirchen auf die Schulen<br />
auszuschalten, wurden nach <strong>der</strong> Regierungsübernahme<br />
<strong>der</strong> Nationalsozialisten<br />
das Katholische und das Evangelische<br />
Oberschulkollegium im September 1932<br />
aufgelöst und dafür - vorläufig - eine katholische<br />
und eine evangelische Abteilung<br />
im Ministerium <strong>der</strong> Kirchen und Schulen<br />
gebildet. Die späteren Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
mit dem nationalsozialistischen Regime<br />
erlebte M. nicht mehr.<br />
L:<br />
Klaus Schaap, Die Endphase <strong>der</strong> Weimarer Republik<br />
im Freistaat <strong>Oldenburg</strong> 1928-1933, Düsseldorf<br />
1978; Kurt Hartong, Lebensbil<strong>der</strong> <strong>der</strong><br />
Bischöflichen Offiziale in Vechta, Vechta o. J.