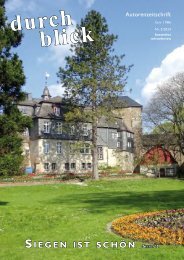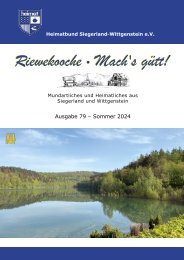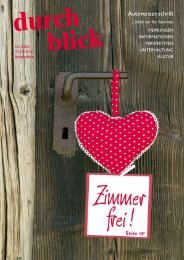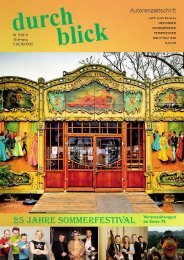Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Aus der Region
Aus der Region
Die Fichte ist Geschichte
Das beschleunigte Sterben einer Baumart
Es gab einmal eine Zeit, da waren im Siegerland noch
keine großräumigen Flächen mit ausschließlich Fichtenbesatz
zu finden. Johann Christian Senckenberg,
Naturwissenschaftler und Namensgeber des bekannten
Frankfurter Naturmuseums, besuchte anno 1736 unsere Region
und notierte in seinem Tagebuch: „Tannen und Fichten
sind wenig oder keine hie.“ Dass ihm dieser Umstand bemerkenswert
erschien, deutet darauf hin, dass er in anderen
Gegenden eine größere Anzahl der immergrünen Nadelbäume
vorgefunden hatte.
Und tatsächlich trat die Fichte ihren Siegeszug in vielen
Teilen Deutschlands schon vor mehr als 300 Jahren an.
Massive „Plünderungen“ der Wälder in Mitteleuropa hatten
dazu geführt, dass in weiten Teilen eine Holzknappheit
vorlag. Die damaligen Förster konnten viele der Landbesitzer
– in der Regel waren es die Grafen und Fürsten – davon
überzeugen, dass es eine Baumart gibt, die nicht nur schnell
wächst, sondern dazu auch noch ein hervorragendes Holz
liefert. Weitere Vorteile waren ihre Anspruchslosigkeit und
der gerade Wuchs. So rasch wie von den Waldbesitzern gewünscht
konnte der Holzmangel zwar nicht behoben werden,
doch angesichts der Alternativen bot sich die Fichte
ganz einfach als allerbeste Wahl an.
Doch es gab auch Gegenden, in denen eine Anpflanzung
von Fichten gar kein Thema war, weil ganz einfach keinerlei
Holznot herrschte – im Gegenteil. Schon viele Generationen
zuvor hatte hier eine Wechselwirtschaft Fuß gefasst, bei der
die andernorts herrschende prekäre Situation praktisch ausgeschlossen
war. Die Basis hierfür war die Nachhaltigkeit
des Verfahrens. Dieses wurde Haubergswirtschaft genannt
und war aus heutiger Sicht eine kulturelle Großtat. Noch
einmal Senckenberg, der bei seinem mehrwöchigen Besuch
eine Zeit lang im Schloss Hainchen wohnte: „Nachdem man
… angehoben (angefangen) Hayne oder Hauberge zu machen,
erholte sich das Landvolck. Die Hauberge sind stets
ein sicher Capital und verzinsen sich wohl.“ Der Frankfurter
schätzte den wirtschaftlichen Wert richtig ein. Dass die hiesige
Bevölkerung ein auskömmliches Dasein genoss, hing
eng mit den aus der Haubergsarbeit stammenden Erzeugnissen
zusammen.
Gelegentlich hört man von ansonsten gut informierten
Personen, dass sie alles, was den Hauberg anbelangt, noch
nie so richtig verstanden hätten. Ich will darum versuchen,
dessen „Geschäftsmodell“ so einfach wie möglich zu erklären.
Auf entbehrliche Einzelheiten soll bei dem „trockenen
Thema“ verzichtet werden.
Beginnen wir mit den Besitzverhältnissen. Die Verfasser
des „Siegerländer Wörterbuchs“ nahmen an, dass diese gegen
Ende des 15. Jahrhunderts grundlegend festgeschrieben
wurden. Die nassauische Regierung verordnete, dass der
gesamte Waldbesitz einer Ortschaft nach bestimmten Regeln
genutzt werden müsse. Jeder Hauseigentümer wurde
mit seinen Besitzanteilen Mitglied in einer Haubergsgenossenschaft.
Durch Erbteilung und Verkauf konnten sich die
ursprünglich gleichgroßen Anteile ändern.
Foto: Wikimedia Commons
Das Konzept entspricht im Prinzip demjenigen einer
Aktiengesellschaft. Deren Grundkapital ist in Aktien zerlegt,
die den Eigentümern auf einer Aktionärsversammlung
ein Stimmrecht sichern. Genau so ist es auch bei der Genossenschaft.
Wer viele Anteile hat, dessen Stimme hat bei
Beschlüssen ein entsprechend größeres Gewicht. Ein ganz
wichtiger Unterschied ist freilich, dass Aktien lediglich
Wertpapiere darstellen – niemand von den Aktionären muss
in der ihm anteilig gehörenden Fabrik arbeiten. Haubergsanteile
hingegen berechtigen den Besitzer, die Produkte der
ihm zugewiesenen Fläche für sich zu nutzen.
Fahren wir fort mit der Methodik der Nachhaltigkeit.
Hierzu wurde der Wald als Gesamteigentum in möglichst
gleich große Bereiche aufgeteilt. In der Regel wurden 16 bis
20 Areale gebildet. Im ersten Jahr wurde eine dieser Teilflächen
gefällt. Jeder Genosse bekam eine Stelle zugelost,
die der Größe seines Anteils entsprach. Im nächsten Jahr
geschah dies bei einer anderen Teilfläche. Da war auf der
Vorjahrsparzelle das aus den Wurzelstöcken nachwachsende
Holz schon wieder ausgetrieben. Und wenn der letzte Bereich
abgeholzt war, dann war der erste wieder schlagreif.
Bei diesem Reihum-Verfahren war gewährleistet, dass Jahr
für Jahr die gleiche Menge Holz zur Verfügung stand. Nachhaltiger
geht es nicht!
Werfen wir nun einen Blick auf die Erzeugnisse, die der
Hauberg lieferte. Da war vor allem natürlich das Brennholz,
das jeder Eigner im Frühjahr „ernten“ durfte. Das Entfernen
des dünnen Unterholzes und der hieraus gefertigten Schanzen
war eine Aufgabe für Frauen und Kinder, während das
Fällen aller Holzarten – vorwiegend waren dies Birken –
ausschließlich eine Sache der Männer war. Eine Ausnahme
bildeten die Eichenstämme. Bei diesen wurde im Mai zunächst
die Rinde abgeschält. Diese enthält einen Gerbstoff,
mit dessen Hilfe man Tierhäute zu Leder umwandelt. Jeder
Eigner fuhr mit seiner Ausbeute zur Gerberei und erwirtschaftete
durch den Verkauf der Rinde („Lohe“ genannt)
einen finanziellen Gewinn. Die Stangen hingegen brachte
man zu den Meilerplätzen. Die hier gewonnene Holzkohle
fand Verwendung bei der Eisenverhüttung und bildete eine
weitere wichtige Einnahmequelle.
Mit Ausnahme einiger Wintermonate zog sich die Bewirtschaftung
über das ganze Jahr hin. Nach der Holzernte
entfernte man vom Boden der kahlen Fläche Gras und
Moos sowie sonstigen Bewuchs, der anschließend in Flammen
aufging. Die Asche bildete den einzigen Dünger für das
„Haubergskorn“, das eingepflügt und im Jahr darauf mit der
Sichel geerntet wurde. Aus dem hieraus gewonnenen Mehl
backte man im gemeindeeigenen Backhaus ein sehr gesundes
Schwarzbrot. Dazu eignete sich das gedroschene Stroh
als Streu im Stall sowie auch ganz gut zum Decken von Dächern.
Nach einem halben Dutzend Jahren durften schließlich
die Hirten bis zum nächsten Holzabtrieb ihre Großviehherde
zur Beweidung in den Hauberg treiben.
Nicht vergessen werden dürfen die Heidelbeeren, die eimerweise
gesammelt und verkauft wurden sowie der Ginster,
der im zweiten Jahr nach der Abholzung urplötzlich in
einer unzählbaren Fülle auflebt und den jungen Hauberg in
ein einziges Blütenmeer verwandelt. Der Ginster ist nicht
nur eine „Augenweide in Gelb“, sondern er wurde früher
ab dem vierten, fünften Jahr nach seinem Auftauchen auch
mit einer „Ginstersichel“ geerntet. Man konnte ihn häckseln
und als Viehstreu verwenden, aber auch – zu Schanzen
gebunden – im Außenbereich von Stall und Scheune als
Kälteschutz aufstellen. Die schönste Haubergsblume indes
blüht im späten Frühling gleichfalls in größeren Mengen im
jungen Wald wieder auf. Es ist der Rote Fingerhut, dessen
purpurne Glockenreihen nicht verraten, dass sie das giftige
Digitalin enthalten, welches als Arzneimittel genutzt wird.
Zusammengefasst sieht man, dass „die Hauberge ein sicher
Capital“ waren und durch den vielfältigen Nutzen dazu
beitrugen, dass die dörfliche Bevölkerung ein hinlängliches
Wohlergehen genoss. Dies sahen auch die Landesherren
so, die ja durch die fälligen Abgaben ebenfalls hiervon profitierten.
Und darum standen die Nassauer und später die
Preußen im Laufe der Jahrhunderte im eigenen Interesse
hinter dem Geschäftsmodell und regelten durch diverse
„Holz- und Waldordnungen“ die Haubergswirtschaft in ihrem
Machtbereich.
Wer sich das bisher Gesagte vor Augen führt, der wird
nicht den geringsten Grund für die eingangs angesprochene
Anpflanzung von Nadelbäumen finden. Bis dass diese einer
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden konnten,
26 durchblick 3/2020 3/2020 durchblick 27