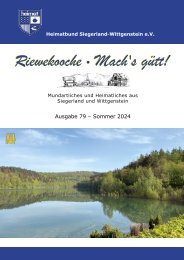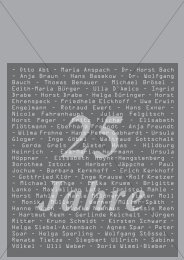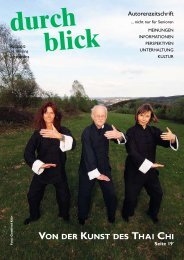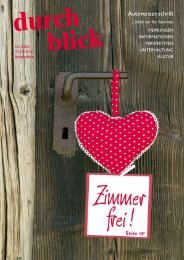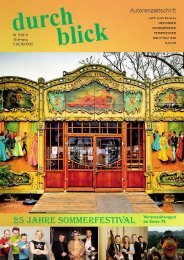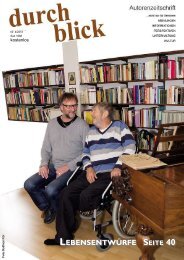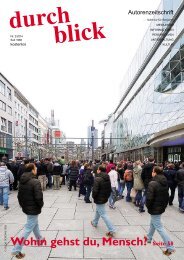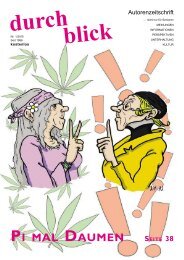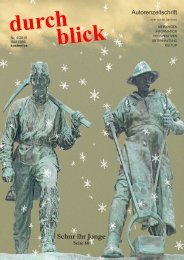Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Unterhaltung
Unterhaltung
Redewendungen aus der Historie
Liebe Leserinnen und Leser, Hand aufs Herz, wie
steht es mit Ihrer Ehrlichkeit? Haben Sie schon einmal
Geld angenommen oder gefunden, das Ihnen
gar nicht zustand? Haben Sie dabei ein schlechtes Gewissen
gehabt? Oder einfach schlicht und ergreifend gedacht:
Geld stinkt nicht! Diese Redewendung würde mir sofort
als Entschuldigung einfallen.
Der römische Kaiser
Vespasian (9 bis 79 n. Chr.)
sann über neue Geldquellen
nach und kam auf die Idee,
eine „Urinsteuer“ einzuführen.
Die gut besuchten
Bedürfnisanstalten wurden
Bild: wikimedia commons
einer Gebührenordnung
unterzogen und jeder Latrinenbenutzer
musste fortan
löhnen! Darüber empörten
sich nicht nur die Bürger,
auch des Kaisers Sohn Titus
war regelrecht verärgert
und hielt diese Abgabe für
ungerecht. Doch Vespasian trat dem entgegen, hielt dem
Sohn das Geld unter die Nase und fragte ihn, ob es streng
rieche? Die lateinische Feststellung: „Pecunia non olet“: Es
stinkt nicht gilt als der Ursprung dieser Redewendung. Bereits
im alten Rom wurde Urin weiterverwertet. Gerbereien
brauchten alten, besonderes gefaulten Urin für die Lederverarbeitung.
Im Urin bildet sich alkalischer Ammoniak, den die
Römer auch für die Reinigung von Wäsche nutzten.
Hier eine weitere Redewendung, die dem einen oder anderen
Leser vielleicht auch schon einmal über die Lippen
kam. Wer hat sich noch nie über eine unentschuldigt fehlende
Person aufgeregt und dann ironisch die Worte durch
Abwesenheit glänzen gedacht oder gesagt? Die Erklärung für
„glänzen“ lässt sich bis in die römische Antike zurück verfolgen.
Marie-Joseph de Chenier (1764-1811) war ein französischer
Dramatiker, der in „Tiberius“, seinem letzten Werk,
schrieb: „Brutus et Cassius brillaient par leur absence“.
Übersetzt: „Brutus und Cassius glänzten durch ihre Abwesenheit“.
Der Satz verweist auf eine Stelle in den „Annalen“
des Tacitus, eines um 116 n. Chr. verstorbenen römischen
Geschichtsschreibers. Ticitus berichtete, dass Junia, die Witwe
des Cassius und Schwester des Brutus bestattet worden
sei, ohne dass die Bildnisse dieser Angehörigen vorangetragen
worden seien. Es war nämlich im alten Rom üblich,
dass bei Leichenbegräbnissen auch Bilder von verstorbenen
Angehörigen und Ahnen gezeigt wurden. Weil aber Brutus
und Cassius als die Mörder von Cäsar galten, durften sie
nach der Bestimmung im kaiserlichen Rom auch nicht als
Bildnisse öffentlich präsentiert werden.
„Zu Dionys, dem Tyrannen schlich, Damon, den Dolch im
Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest
du mit dem Dolche, sprich!“ Wer kennt noch den ganzen Text
dieser Ballade, die aus der Feder Friedrich Schillers stammt?
Unsere nächste Redensart spielte sich in Syracus im Hause jenes
beschriebenen Zeitgenossen ab. Damokles lebte um 400
v. Chr. in Syrakus als Günstling seines Herren, nämlich des
Tyrannen Dionysios I. Aber auch bei allem Wohlwollen, aller
Huld und Gewogenheit, und dazu neigten die Menschen zu
allen Zeiten, Damokles beneidete seinen Herrn und Herrscher
um seine Macht und sein Glück. Dies blieb natürlich dem Tyrannen
nicht verborgen und er sann über eine List nach. Bei
einem opulenten Mahl ließ Dionysios über dem Haupt des
Damokles ein Schwert an einem dünnen Rosshaar befestigen,
um ihm so die ständige Bedrohung und das Risiko des Lebens
vor Augen zu führen. Diese Überlieferung steht für die
Redewendung unter dem Damoklesschwert leben.
Aus der Antike kennen wir den Begriff: die Gelegenheit
beim Schopfe packen und hier denkt jeder sogleich an den
pfiffigen Baron von Münchhausen. Er erzählte zwar auch,
er habe sich an seinem eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen,
Das ist aber nicht der Ursprung. Eine viel ältere
Überlieferung, die aus der griechischen Mythologie stammt,
ist an ein sprachliches Bild, dem „Kairomythos“ angelehnt.
Der als Gott verehrte Kairo, der auch in Olympia sehr verehrt
wurde, verkörperte das sprachliche Bild des günstigen Augenblickes.
Dargestellt wurde er mit seiner langen Stirnlocke,
aber einem kurz geschorenen Hinterkopf. Teilweise auch als
Davonfliegender, der eine günstigste Gelegenheit meist dann
zu greifen suchte, wenn es zu spät war. Der Dichter Poseidippos
von Pella beschrieb im dritten Jahrhundert v. Chr. Dialoge
des Kairo, wie wir uns ihn als Menschen vorstellen könnten,
und deren Wortlaute klingen schon arg eigenartig:
„Wer bist du?
Ich bin Kairos, der alles bezwingt!
Warum läufst du auf Zehenspitzen?
Ich, der Kairos, laufe unablässig.
Warum hast du Flügel am Fuß?
Ich fliege wie der Wind.
Warum trägst du in deiner Hand ein spitzes Messer?
Um die Menschen daran zu erinnern,
dass ich spitzer bin als ein Messer.
Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn?
Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet.
Warum bist du am Hinterkopf kahl?
Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin,
wird mich auch keiner von hinten erwischen
so sehr er sich auch bemüht.
Und wozu schuf Euch der Künstler?
Euch Wanderern zur Belehrung.“
Obwohl bekannt ist, dass bereits um das Jahr 1000 Leif
Eriksson, (der Sohn Eriks des Roten) amerikanischen Boden
betreten hatte, gilt nach wie vor Kolumbus als der Entdecker
Amerikas. Eriksson landete in Neufundland und benannte
diesen Teil „Vinland“. Christoph Kolumbus landete am 12.
Oktober 1492 in der Karibik. Von hier aus setzte die kontinuierliche
Erkundung des Kontinents ein. Die Geschichte über
Kolumbus und wie er die Neue Welt entdeckte, kennen wir
wohl alle von Kindesbeinen an und selbstverständlich auch
die Sache mit dem Ei des Kolumbus. Nach seiner Rückkehr,
als gefeierter Weltumsegler, soll es einmal während eines Essens
bei einem Kardinal geheißen haben, dass so eine Entdeckung
eigentlich ganz leicht sei Die neue Welt hätte jeder
andere auch finden können! Welch ein Affront! Kolumbus
bat um ein Ei und forderte alle Anwesenden auf das Ei auf
die Spitze zu stellen. Es gelang niemand und wurde als schier
unmöglich angesehen. Kolumbus nimmt das Ei, drückt die
Spitze auf den Tisch und es steht! Die Gäste protestierten, so
hätten sie es auch tun können, worauf Kolumbus antwortet:
„Sie hätten es tun können, aber ich habe es getan“.
In der griechischen Sage wurden die Seile am Streitwagen
des phrygischen Königs Gordios kunstvoll verknotet.
Für Detailliebhaber: Der Streitwagen gehörte, als Statussymbol,
dem Gründer des Phrygierreichs in Kleinasien.
Die aus dem Bast der Kornelkirsche bestehenden gedrehten
Seile waren besonders strapazierfähig. Mit einem besonders
stabilen Knoten hielten sie das Joch und die Deichsel zusammen.
Der Knoten, nach seinem Landesherrn benannt,
galt lange als legendär und ebenso unlösbar. Alexander der
Große fand im Jahre 333 v. Chr. eine einfache Lösung, er
durchschlug den gordischen Knoten mit seinem Schwert, so
wurde eine aus einer simplen Problemlösung der Ursprung
der Redewendung, den Gordischen Knoten lösen.
Bleiben wir noch etwas in der Antike. Das Daumen drücken
etwas mit dem Glück wünschen zu tun hat oder damit,
in Gedanken jemand zu unterstützen, belegt ein Zitat des
römischen Naturforschers Plinius des Älteren. Er trug schon
im ersten Jahrhundert n. Chr. das zur damaligen Zeit gesammelte
naturkundliche Wissen zusammen. In einem Kapitel
über Heilmittel findet sich der Hinweis: „Pollices, cum faveamus,
premere etiam proverbio iubemur“. Dieser Satz
lautet frei übersetzt: „Schon das Sprichwort fordert uns auf,
die Daumen zu drücken, wenn wir jemandem geneigt sind“.
Auch bei Gladiatorenkämpfen war es offenbar eine übliche
Geste des Publikums die Daumen zu drücken, um über das
Schicksal von Wettkämpfern abzustimmen.
Nach dem germanischen Volksglauben galt der Daumen
als Glücksfinger, wobei das Einschlagen des Daumens
innerhalb der Handfläche vor Dämonen und Albträumen
schützen sollte.
Wer in der Zeit der Aufklärung die Ehre eines Gegners
grob verletzt hatte, warf seinem Kontrahenten einen Handschuh
vor die Füße. Einen Fehdehandschuh werfen symbolisierte
die ehrenhafte Herausforderung zu einem Zweikampf.
Wurde der Handschuh aufgenommen, war der Kampf akzeptiert.
Das Wort Fehdehandschuh war im Mittelalter noch
nicht bekannt, diese Redewendung ist erst im 18. Jahrhundert
aufkommen. Friedrich Schiller verwendete 1798 das
Motiv in seiner Ballade: „Der Handschuh“. „Nimmt er den
Handschuh mit keckem Finger. Sehns die Ritter und Edelfrauen,
Und gelassen bringt er den Handschuh zurück“.
Wer kennt sich noch in den alten griechischen Göttersagen
aus? Auf Kreta, im Reich des Königs Minos hauste
Minotaurus, ein Stier in einem Labyrinth. Minos störte sich
daran und wollte ihn los werden. Er bot demjenigen, der ihn
von dem Stier befreite, seine Tochter Ariadne zur Frau an.
Theseus der heimliche Geliebte von Ariadne kam das gut
zu pass und er stellte sich der Herausforderung. Mit einer
List half Ariadne
ihren Geliebten
die Aufgabe zu bestehen.
Sie steckte
Theseus ein Fadenknäuel
zu, damit
er sich bei der
mörderischen Aufgabe
im Labyrinth
nicht verlaufen
konnte. Tatsächlich
gelang es ihm
das Tier zu besiegen.
Und weil er
den Faden nicht
verloren hatte,
stand dem jungen
Glück nichts mehr
im Wege.
Eva-M. Herrmann
Bild: wikimedia commons
Theseus und Ariadne
64 durchblick 3/2020 3/2020 durchblick 65