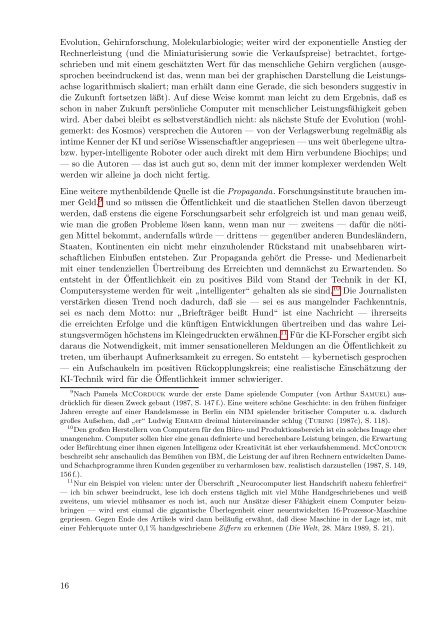Können Computer denken? Teil 1 - Didaktik der Informatik
Können Computer denken? Teil 1 - Didaktik der Informatik
Können Computer denken? Teil 1 - Didaktik der Informatik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Evolution, Gehirnforschung, Molekularbiologie; weiter wird <strong>der</strong> exponentielle Anstieg <strong>der</strong><br />
Rechnerleistung (und die Miniaturisierung sowie die Verkaufspreise) betrachtet, fortgeschrieben<br />
und mit einem geschätzten Wert für das menschliche Gehirn verglichen (ausgesprochen<br />
beeindruckend ist das, wenn man bei <strong>der</strong> graphischen Darstellung die Leistungsachse<br />
logarithmisch skaliert; man erhält dann eine Gerade, die sich beson<strong>der</strong>s suggestiv in<br />
die Zukunft fortsetzen läßt). Auf diese Weise kommt man leicht zu dem Ergebnis, daß es<br />
schon in naher Zukunft persönliche <strong>Computer</strong> mit menschlicher Leistungsfähigkeit geben<br />
wird. Aber dabei bleibt es selbstverständlich nicht: als nächste Stufe <strong>der</strong> Evolution (wohlgemerkt:<br />
des Kosmos) versprechen die Autoren — von <strong>der</strong> Verlagswerbung regelmäßig als<br />
intime Kenner <strong>der</strong> KI und seriöse Wissenschaftler angepriesen — uns weit überlegene ultrabzw.<br />
hyper-intelligente Roboter o<strong>der</strong> auch direkt mit dem Hirn verbundene Biochips; und<br />
— so die Autoren — das ist auch gut so, denn mit <strong>der</strong> immer komplexer werdenden Welt<br />
werden wir alleine ja doch nicht fertig.<br />
Eine weitere mythenbildende Quelle ist die Propaganda. Forschungsinstitute brauchen immer<br />
Geld, 9 und so müssen die Öffentlichkeit und die staatlichen Stellen davon überzeugt<br />
werden, daß erstens die eigene Forschungsarbeit sehr erfolgreich ist und man genau weiß,<br />
wie man die großen Probleme lösen kann, wenn man nur — zweitens — dafür die nötigen<br />
Mittel bekommt, an<strong>der</strong>nfalls würde — drittens — gegenüber an<strong>der</strong>en Bundeslän<strong>der</strong>n,<br />
Staaten, Kontinenten ein nicht mehr einzuholen<strong>der</strong> Rückstand mit unabsehbaren wirtschaftlichen<br />
Einbußen entstehen. Zur Propaganda gehört die Presse- und Medienarbeit<br />
mit einer tendenziellen Übertreibung des Erreichten und demnächst zu Erwartenden. So<br />
entsteht in <strong>der</strong> Öffentlichkeit ein zu positives Bild vom Stand <strong>der</strong> Technik in <strong>der</strong> KI,<br />
<strong>Computer</strong>systeme werden für weit ” intelligenter“ gehalten als sie sind. 10 Die Journalisten<br />
verstärken diesen Trend noch dadurch, daß sie — sei es aus mangeln<strong>der</strong> Fachkenntnis,<br />
sei es nach dem Motto: nur ” Briefträger beißt Hund“ ist eine Nachricht — ihrerseits<br />
die erreichten Erfolge und die künftigen Entwicklungen übertreiben und das wahre Leistungsvermögen<br />
höchstens im Kleingedruckten erwähnen. 11 Für die KI-Forscher ergibt sich<br />
daraus die Notwendigkeit, mit immer sensationelleren Meldungen an die Öffentlichkeit zu<br />
treten, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen. So entsteht — kybernetisch gesprochen<br />
— ein Aufschaukeln im positiven Rückopplungskreis; eine realistische Einschätzung <strong>der</strong><br />
KI-Technik wird für die Öffentlichkeit immer schwieriger.<br />
9 Nach Pamela McCorduck wurde <strong>der</strong> erste Dame spielende <strong>Computer</strong> (von Arthur Samuel) ausdrücklich<br />
für diesen Zweck gebaut (1987, S. 147 f.). Eine weitere schöne Geschichte: in den frühen fünfziger<br />
Jahren erregte auf einer Handelsmesse in Berlin ein NIM spielen<strong>der</strong> britischer <strong>Computer</strong> u. a. dadurch<br />
großes Aufsehen, daß ” er“ Ludwig Erhard dreimal hintereinan<strong>der</strong> schlug (Turing (1987c), S. 118).<br />
10 Den großen Herstellern von <strong>Computer</strong>n für den Büro- und Produktionsbereich ist ein solches Image eher<br />
unangenehm. <strong>Computer</strong> sollen hier eine genau definierte und berechenbare Leistung bringen, die Erwartung<br />
o<strong>der</strong> Befürchtung einer ihnen eigenen Intelligenz o<strong>der</strong> Kreativität ist eher verkaufshemmend. McCorduck<br />
beschreibt sehr anschaulich das Bemühen von IBM, die Leistung <strong>der</strong> auf ihren Rechnern entwickelten Dameund<br />
Schachprogramme ihren Kunden gegenüber zu verharmlosen bzw. realistisch darzustellen (1987, S. 149,<br />
156 f.).<br />
11 Nur ein Beispiel von vielen: unter <strong>der</strong> Überschrift ” Neurocomputer liest Handschrift nahezu fehlerfrei“<br />
— ich bin schwer beeindruckt, lese ich doch erstens täglich mit viel Mühe Handgeschriebenes und weiß<br />
zweitens, um wieviel mühsamer es noch ist, auch nur Ansätze dieser Fähigkeit einem <strong>Computer</strong> beizubringen<br />
— wird erst einmal die gigantische Überlegenheit einer neuentwickelten 16-Prozessor-Maschine<br />
gepriesen. Gegen Ende des Artikels wird dann beiläufig erwähnt, daß diese Maschine in <strong>der</strong> Lage ist, mit<br />
einer Fehlerquote unter 0,1 % handgeschriebene Ziffern zu erkennen (Die Welt, 28. März 1989, S. 21).<br />
16