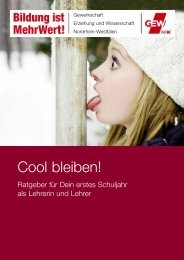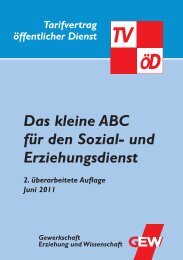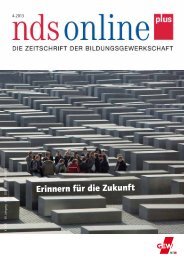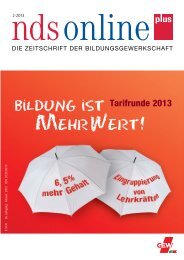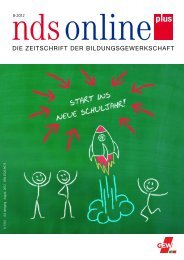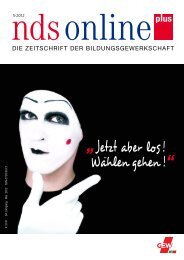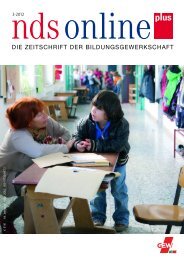speichern
speichern
speichern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Visionäre Ziele<br />
Jedes siebte Kind auf der Welt muss arbeiten. Doch wo genau fängt Kinderarbeit eigentlich<br />
an? Was muss dagegen getan werden? Und wie sind die Erfolgsaussichten im Kampf gegen<br />
Kinderarbeit? Eine Bestandsaufnahme der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).<br />
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) kämpft seit<br />
vielen Jahren weltweit für die Abschaffung der Kinderarbeit.<br />
Die Anstrengungen haben inzwischen zu einigen<br />
Erfolgen geführt: Zwischen 2004 und 2008 ging die Zahl<br />
der Kinderarbeiter immerhin von 222 Millionen auf 215<br />
Millionen zurück.<br />
Wo genau fängt Kinderarbeit an? Die ILO setzt das Mindestalter,<br />
ab dem Jugendliche arbeiten dürfen, bei 15<br />
Jahren an. Ab 13 dürfen Kinder wöchentlich einige Stunden<br />
leichte Arbeit verrichten, zum Beispiel auf dem Hof<br />
oder im Laden der Eltern mithelfen – wie viele Stunden<br />
genau, können die ILO-Mitgliedsstaaten selbst festlegen.<br />
Entscheidend ist, dass dadurch der Schulbesuch nicht infrage<br />
gestellt ist.<br />
1999 wurde überdies ein ILO-Übereinkommen verabschiedet,<br />
das die schlimmsten Formen der Kinderarbeit verbietet,<br />
und zwar für alle Kinder und Jugendlichen unter 18<br />
Jahren. Dies umfasst Kinderprostitution und -pornografi e,<br />
den Einsatz als Soldaten, illegale Tätigkeiten wie Drogenschmuggel<br />
sowie generell Arbeit, die „für die Gesundheit,<br />
die Sicherheit oder die Sittlichkeit schädlich ist“ – also zum<br />
Beispiel das Tragen schwerer Lasten, Arbeit unter Tage,<br />
der Umgang mit gefährlichen Chemikalien oder Maschinen<br />
oder sehr lange Arbeitszeiten.<br />
Vor sechs Jahren setzte sich die ILO ein visionäres Ziel: die<br />
schlimmsten Formen der Kinderarbeit bis 2016 zu beseitigen.<br />
Ist das realistisch? Die Statistiken zeigen Fortschritte,<br />
aber auch beunruhigende Lücken. „So wie die Dinge heute<br />
liegen, reicht das Tempo des Fortschritts nicht aus, um<br />
das für 2016 angepeilte Ziel zu erreichen“, hieß es 2010<br />
in einem ILO-Report.<br />
Immer noch ist die Zahl von 115 Millionen Kindern in<br />
gefährlicher Arbeit – 7,3 Prozent aller Kinder zwischen 5<br />
und 17 – erschütternd hoch. Während die Zahl der Kinderarbeiter<br />
insgesamt zwischen 2004 und 2008 um nur gut<br />
3 Prozent sank, betrug der Rückgang bei den Kindern in<br />
gefährlicher Arbeit jedoch immerhin mehr als 10 Prozent.<br />
Bei den Mädchen schrumpfte die Zahl sogar um fast ein<br />
Viertel. Diese Trends können als Anzeichen dafür gelten,<br />
dass die Politik Prioritäten gesetzt hat und dass entsprechende<br />
Bemühungen von Staat und Zivilgesellschaft tatsächlich<br />
einen Unterschied machen.<br />
Ein bloßes gesetzliches Verbot ist allerdings keine Lösung.<br />
Die meisten Kinder arbeiten schließlich, weil es für ihr<br />
eigenes Überleben oder das der Familie notwendig ist.<br />
Bei diesen Problemen setzt das Programm der ILO zur<br />
Abschaffung der Kinderarbeit (IPEC) an. Dabei hat sich<br />
gezeigt: Entscheidend sind neben der Armutsbekämpfung<br />
insbesondere Bildungsangebote und auch die Bekämpfung<br />
von HIV/AIDS, damit Kinder nicht für erkrankte oder<br />
verstorbene Elternteile einspringen müssen.<br />
Brasilien bietet ein gutes Beispiel, wie ein Staat die Kinderarbeit<br />
erfolgreich bekämpft. Die Regierung führte eine<br />
Schulpfl icht ein, die inzwischen neun Jahre beträgt. Hinzu<br />
kommen Angebote für die Nachschulzeit, vor allem für<br />
Kinder auf dem Land. Mobile Arbeitsinspektionseinheiten<br />
überprüfen die Einhaltung der Gesetze gegen Kinderarbeit.<br />
Und seit 2003 bietet ein Sozialhilfeprogramm<br />
armen Familien fi nanzielle Unterstützung – jedoch nur,<br />
wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken und impfen<br />
lassen.<br />
Die Folge: Seit 1992 fi el in Brasilien die Kinderarbeitsquote<br />
in der Altersgruppe 5 bis 15 Jahre von 13,6 Prozent auf 7,3<br />
Prozent im Jahr 2005. Solche Erfolgsmodelle zeigen: Der<br />
Kampf gegen die Kinderarbeit kann gewonnen werden.<br />
pluspunkt<br />
Nicola Liebert<br />
Sprecherin der Internationalen Arbeitsorganisation<br />
(ILO) in Deutschland<br />
Der Artikel ist die stark gekürzte Fassung eines<br />
Aufsatzes in „Aus Politik und Zeitgeschichte“<br />
(Ausgabe 43/2012) vom 22. Oktober 2012.<br />
Das komplette Heft ist online erhältlich.<br />
www.<br />
punktlandung 2012.2<br />
3