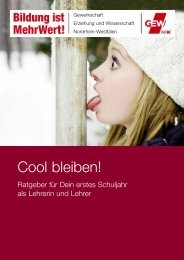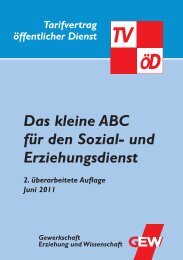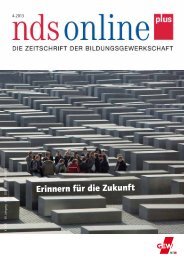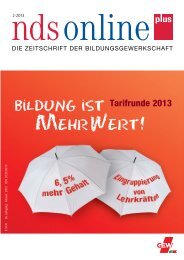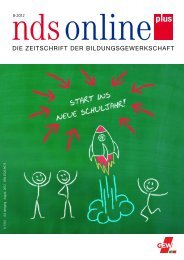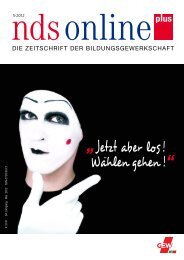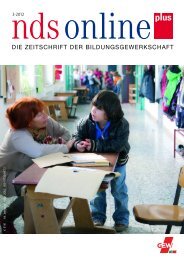speichern
speichern
speichern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
den Hartz-IV-Regelsätzen) für alle TransferleistungsbezieherInnen<br />
zu gewährleisten, tritt er<br />
dieses Verfassungsgebot ausgerechnet bei<br />
jungen Menschen mit Füßen.<br />
Extrem hart trafen die Leistungskürzungen<br />
junge Menschen, die von zu Hause ausziehen<br />
und als Arbeitsuchende mittels der Grundsicherung<br />
nach dem SGB II lieber eine eigene<br />
Bedarfsgemeinschaft gründen wollten, als im<br />
Haushalt ihrer Eltern zu verbleiben.<br />
Heranwachsende und junge Erwachsene<br />
wieder in der Abhängigkeit von ihren Eltern zu<br />
belassen und ihnen per Mittelentzug die Möglichkeit<br />
der Gründung eines eigenen Hausstandes<br />
zu nehmen, ist einer wohlhabenden<br />
und hoch individualisierten Gesellschaft, die<br />
im Zeichen der Globalisierung berufliche Flexibilität<br />
und geografische Mobilität von ihren<br />
Mitgliedern verlangt, unwürdig.<br />
Schulkinder und Jugendliche sind die beiden<br />
einzigen Personengruppen, deren Hartz-IV-Regelsatz<br />
seit 2009 nicht mehr erhöht worden ist.<br />
Stattdessen wurde ihnen bei der gesetzlichen<br />
Neuregelung von Hartz IV im Frühjahr 2011<br />
ein „Bildungs- und Teilhabepaket“ im Wert von<br />
250 EUR pro Jahr zugestanden. Dieses stellt<br />
nicht bloß ein soziales Placebo, sondern auch<br />
eine politische Mogelpackung dar. Denn neu<br />
waren dabei nur 120 EUR pro Jahr, und was<br />
sind schon 10 EUR im Monat mehr für ein<br />
Schulkind oder einen Jugendlichen? Lässt sich<br />
damit sein „Bedarf zur Teilhabe am sozialen<br />
und kulturellen Leben in der Gemeinschaft“<br />
(Gesetzestext) wirklich erfüllen?<br />
Intervention und Prävention<br />
Erforderlich ist ein Konzept, das unterschiedliche<br />
Politikfelder (Beschäftigungs-,<br />
Bildungs-, Familien- und Sozialpolitik) miteinander<br />
vernetzt und Maßnahmen zur Umverteilung<br />
von Arbeit, Einkommen und Vermögen<br />
einschließt. Durch separate und voneinander<br />
isolierte Schritte, etwa höhere Transferleistungen,<br />
sind die prekären Lebenslagen von<br />
Jugendlichen nur partiell zu verbessern, ihre<br />
tief sitzenden Ursachen aber schwerlich zu beseitigen.<br />
Ein integrales Konzept zur Verringerung<br />
und Vermeidung von Jugendarmut muss<br />
gesetzliche (Neu-)Regelungen sowie monetäre<br />
und Realtransfers umfassen. Individuelle<br />
und erzieherische Hilfen, Fördermaßnahmen<br />
für junge Menschen sowie Strukturreformen<br />
sollten einander sinnvoll ergänzen und so<br />
verzahnt werden, dass möglichst wenig Reibungsverluste<br />
zwischen den verschiedenen<br />
Institutionen und Trägern entstehen.<br />
Aufgabe der Pädagogik –<br />
Verantwortung der Schulen<br />
Eine bessere, die Schule weniger auf soziale<br />
Selektion ausrichtende, Bildungspolitik wäre<br />
ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Armut<br />
junger Menschen. Die durch Jugendarmut<br />
verstärkte Chancenungleichheit in der Gesellschaft<br />
bildet eine zentrale Herausforderung für<br />
die Schule. Da eine soziale Infrastruktur weitgehend<br />
fehlt, liegt hier – neben der notwendigen<br />
Erhöhung monetärer Transfers zu Gunsten<br />
sozial benachteiligter Jugendlicher – ein<br />
wichtiger Ansatzpunkt für Gegenmaßnahmen.<br />
Ganztagsschulen hätten einen pädagogischsozialen<br />
Doppeleffekt: Einerseits könnten von<br />
Armut betroffene oder bedrohte Jugendliche<br />
systematischer gefördert werden als bisher, andererseits<br />
könnten ihre Eltern leichter als sonst<br />
einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen, was<br />
sie finanzielle Probleme besser meistern ließe.<br />
Durch die Ganztags- als Regelschule lassen<br />
sich soziale Handicaps insofern kompensieren,<br />
als eine bessere Versorgung der Kinder, eine gezielte<br />
Unterstützung vor allem leistungsschwächerer<br />
SchülerInnen bei der Erledigung von<br />
Hausaufgaben und eine sinnvollere Gestaltung<br />
der Freizeit möglich wären.<br />
Ohne mehr Sensibilität für gesellschaftliche<br />
Spaltungs- und massive Verarmungstendenzen<br />
im Gefolge der globalen Finanz- und Weltwirtschaftskrise<br />
wird es keine Solidarität mit armen<br />
Jugendlichen geben. Das Thema „Kinder- und<br />
Jugendarmut“ muss im Rahmen der Lehrerausbildung<br />
stärker berücksichtigt werden. Das Armutsthema<br />
sollte auch stärker als bisher Teil der<br />
Curricula werden, und zwar nicht mehr nur bezogen<br />
auf Not und Elend der sog. Dritten Welt.<br />
Zwar kann die Pädagogik eine konsequente<br />
Politik gegen Armut nicht ersetzen, sie muss aber<br />
dafür sorgen, dass diese Problematik trotz emotionaler<br />
Barrieren und rationaler Bedenken auf die<br />
Agenda gesetzt wird: Die weitgehende Tabuisierung<br />
der Jugendarmut ist ein geistig-moralisches<br />
Armutszeugnis für das reiche Deutschland (vgl.<br />
Butterwegge, „Armut in einem reichen Land.<br />
Wie das Problem verharmlost und verdrängt<br />
wird", 3. Auflage 2012, Campus-Verlag).<br />
Christoph Butterwegge<br />
Prof. Dr. Christoph Butterwegge<br />
Humanwissenschaftliche<br />
Fakultät – Politikwissenschaft<br />
Universität zu Köln<br />
Jugendarmut<br />
Yvonne Ploetz (Hg.)<br />
nds 10-2012<br />
Beiträge zur Lage in Deutschland<br />
320 S., ISBN 978-3-86649-484-8,<br />
Budrich-Verlag, 10/2012, 33 Euro<br />
Die Verarmung großer Teile junger Menschen<br />
nimmt zu. Welche politischen Instrumente<br />
sind denkbar, um diesen Jugendlichen<br />
(wieder) eine Zukunft zu eröffnen?<br />
Die AutorInnen setzen sich mit Ursachen<br />
und Auswirkungen von Jugendarmut in<br />
der Bundesrepublik auseinander und diskutieren<br />
Auswege. Beiträge von: Ronald<br />
Lutz, Hans-Peter Michels, Christoph Butterwegge,<br />
Max Koch, Werner Seppmann und<br />
vielen anderen. Se<br />
Das Meer im Nebel<br />
Muñoz, Vernor<br />
Bildung auf dem Weg<br />
zu den Menschenrechten<br />
95 S., ISBN 978-3-86649-374-2,<br />
Budrich-Verlag, 10/2012, 9,90 Euro<br />
Vernor Muñoz begreift „Bildung als Menschenrecht"<br />
als Übergang der Menschheit<br />
vom patriarchalen Gesellschaftsrahmen hin zu<br />
einer universellen Kultur der Menschenrechte.<br />
Der langjährige UN-Sonder bericht erstatter für<br />
das Recht auf Bildung schlägt deshalb vor,<br />
Qualität und Wirkung der Bildung als Elemente<br />
der Entwicklung einer sozialen Sprache<br />
und Verfasstheit aufzufassen, die dem Leben<br />
seine Würde bewahrt. Unbedingt lesen! Se<br />
9