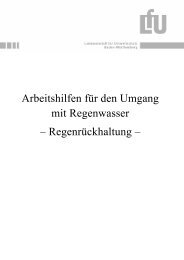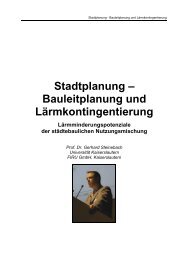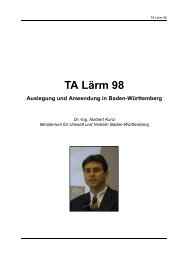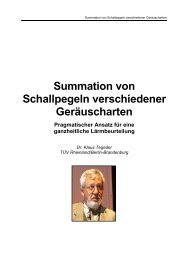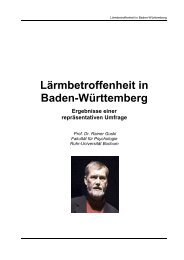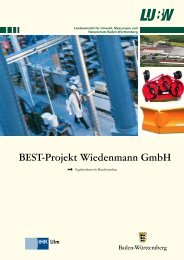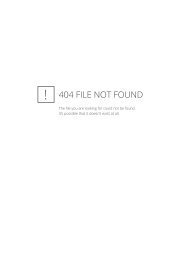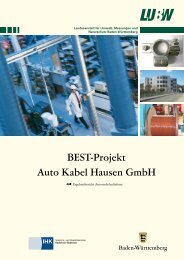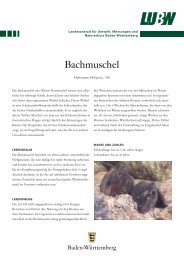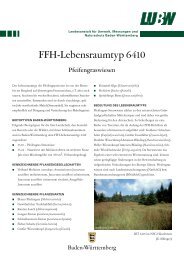Naturschutz Info 1/2012 - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und ...
Naturschutz Info 1/2012 - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und ...
Naturschutz Info 1/2012 - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
grindenvegetation im<br />
nordschwarzwald – erfahrungen mit<br />
einführung<br />
renaturierungsmaßnahmen im<br />
nsg wilder see–hornisgrinde<br />
Text: Luise Murmann-Kristen<br />
Ein ganz eigener Vegetationstyp ist die Vegetation der<br />
Grinden im Nordschwarzwald. Sie erinnert an die Deckenmoore<br />
der atlantisch geprägten britischen Inseln. Die trockenen<br />
Ausprägungen sind von Heide dominiert, die feuchten<br />
bis nassen zeigen Anklänge an Hochmoorvegetation.<br />
Das ganze Jahr über zieht die vielfältige Landschaft mit<br />
den offenen, von Moorkiefern umgebenen Grindenflächen<br />
Ausflügler <strong>und</strong> Touristen an. Die Flächen sind überwiegend<br />
als <strong>Naturschutz</strong>gebiete (NSG) unter Schutz gestellt <strong>und</strong><br />
gleichzeitig Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes<br />
Natura 2000 im Nordschwarzwald.<br />
Besonders die Feuchtheiden <strong>und</strong> Rasenbinsenmoore sind<br />
durch alte Entwässerungsgräben <strong>und</strong> zunehmend trockene<br />
Frühjahrs- <strong>und</strong> Sommerphasen in ihrem Bestand gefährdet.<br />
Den Wasserhaushalt dieser Standorte zu stützen ist daher<br />
schon seit langem Ziel der <strong>Naturschutz</strong>verwaltung. Zugleich<br />
ist klar, dass Maßnahmen nur nach genauer hydrologischer<br />
Analyse <strong>und</strong> sehr behutsam vorgenommen werden können.<br />
Ein solcher Praxisversuch wurde an einem kleinen Moor im<br />
Rahmen des LIFE-Projektes „Grindenschwarzwald“ durchgeführt.<br />
Vom Monitoring dieser Fläche am Pfälzerkopf liegt<br />
nun erstmals eine Wiederholungsuntersuchung vor.<br />
Auch von der Entwicklung einer Einsaat auf einer Baufläche<br />
in der benachbarten Feuchtheide liegen Monitoring-<br />
Ergebnisse, im Vergleich zu einer spontanen Wiederbegrünung,<br />
vor. Dort war die Grindenvegetation 2005 durch<br />
Neuverlegung einer Pipeline zerstört worden.<br />
wiedervernässung einer moorfläche<br />
am pfälzerkopf<br />
Das Moor liegt auf einem Bergsattel nordöstlich des Ruhesteins,<br />
fast 1.000 m über NN. Der nördliche Moorbereich<br />
ist offen, im südlichen Teil ist es von Moorkiefern bestanden.<br />
Das Ziel der Wiedervernässungsmaßnahmen war die<br />
Anhebung des mooreigenen Wasserstandes. Damit sollten<br />
das Torfwachstum angeregt <strong>und</strong> die Zwergsträucher – vor<br />
allem Heidekraut <strong>und</strong> Heidelbeere – zurückgedrängt werden.<br />
Der Torf des Moores war zu Maßnahmenbeginn bereits<br />
stark zersetzt. Es herrschten daher <strong>für</strong> den Grabeneinstau<br />
eher ungünstige Verhältnisse. Andererseits war durch das<br />
geringe Gefälle ein Anheben des Moorwasserspiegels auf<br />
größerer Fläche mit relativ geringem Aufwand durchführbar.<br />
Im Moor wurden an fünf Stellen Sperren eingebaut, die Sperren<br />
wurden aus Eichenbohlen als Doppelsperren erstellt.<br />
Zur Erfolgskontrolle wurden fünf, jeweils vier Quadrat meter<br />
große Dauerquadrate angelegt <strong>und</strong> vegetationsk<strong>und</strong>lich<br />
aufgenommen. Eine floristische Inventarisierung <strong>und</strong> Strukturerhebungen<br />
im Umfeld der Quadrate ergänzten die Dauerflächenaufnahmen.<br />
Nach dem Einbau der Sperren 2005<br />
wurde 2006 der Zustand der Flächen erstmals erhoben.<br />
Die Vegetation konnte noch als Bunte Torfmoosgesellschaft<br />
(Sphagnetum magellanici) angesprochen werden, jedoch<br />
stark dominiert von der Besenheide (Calluna vulgaris).<br />
Am südlichen <strong>und</strong> westlichen Rand war die Fläche wie erwähnt<br />
locker mit Moorkiefer (Pinus mugo ssp. rot<strong>und</strong>ata)<br />
bestockt. Als Arten der Zielvegetation wurden Scheidiges<br />
Wollgras (Eriophorum vaginatum) <strong>und</strong> Rasenbinse<br />
(Trichophorum germanicum) sowie eine Reihe von <strong>für</strong><br />
Hochmoore charakteristischen Moosarten (u. a. Dicranum<br />
bergeri, Odontoschisma sphagni, Sphagnum magellanicum,<br />
Sphagnum nemoreum) definiert. Im Jahre 2011 wurden die<br />
Aufnahmen zu einer ersten Erfolgskontrolle wiederholt.<br />
Die Anzahl der Arten der Zielvegetation blieb in diesem<br />
Zeitraum unverändert. Die Deckungssumme der Zielvegetation<br />
hatte etwas zugenommen. Störzeiger waren nicht<br />
aufgetreten. Das Heidekraut (Calluna vulgaris) hatte<br />
in den fünf Jahren an Deckung verloren, das Wollgras<br />
(Eriophorum vaginatum) an Häufigkeit zugenommen. Das<br />
Urteil des Gutachters 2011 lautete: „Die vorgenommene<br />
Sperrung der Gräben hat sich bisher günstig auf die Vegetation<br />
<strong>und</strong> die Vorkommen wertgebender Arten ausgewirkt.<br />
Weitere Maßnahmen erscheinen nicht erforderlich.“<br />
wiederherstellung der grindenvegetation<br />
durch heudruschansaat<br />
Durch die Neuverlegung eines Pipeline-Abschnitts an der<br />
Nordseite des Moores ergaben sich offene Rohbodenflächen,<br />
die – da diese im NSG Wilder See–Hornisgrinde<br />
<strong>Naturschutz</strong><strong>Info</strong> 1/<strong>2012</strong> 61