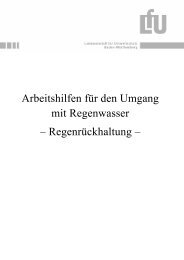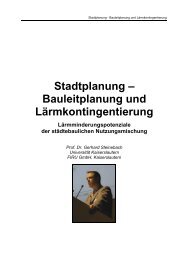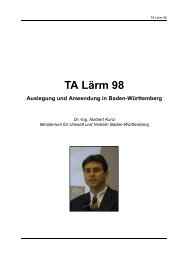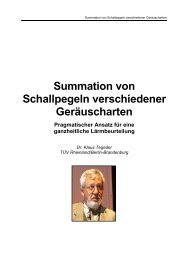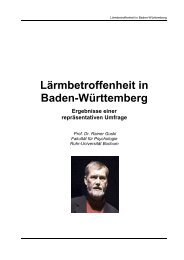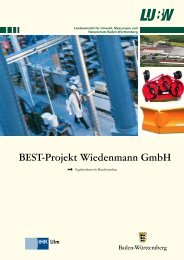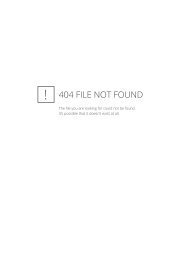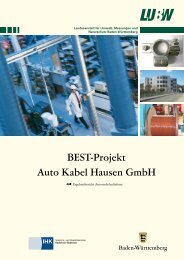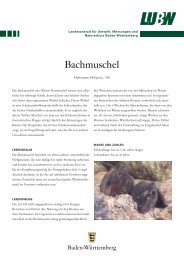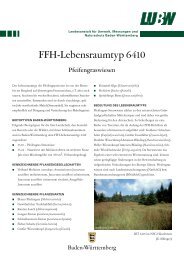Naturschutz Info 1/2012 - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und ...
Naturschutz Info 1/2012 - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und ...
Naturschutz Info 1/2012 - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
landschaftspflege <strong>und</strong> landschaftsentwicklung<br />
liegen – möglichst rasch wieder mit grindentypischer<br />
Vegetation besiedelt werden sollten. 2005 erfolgte auf<br />
einem Teil der Baufläche eine Ansaat mit Heudrusch aus<br />
einem Magerwiesen-Magerrasen-Komplex bei Herrenwies.<br />
Als Zielvegetation wurde ein Mosaik aus Borstgrasrasen,<br />
Torfbinsen-Borstgrasrasen <strong>und</strong> Rasenbinsen-Feuchtheide<br />
definiert. Die Erstaufnahme erfolgte 2006, die Wiederholungsuntersuchung<br />
ebenfalls 2011, methodisch gleich wie<br />
auf den Flächen der Wiedervernässung.<br />
Sowohl die eingesäte als auch die nicht eingesäte Fläche<br />
starteten 2006 mit sehr schütterer Vegetation unter 10 %<br />
Deckung. Fünf Jahre später hatte die eingesäte Fläche über<br />
50 % Deckung, die Teilfläche ohne Einsaat zwischen 20 <strong>und</strong><br />
40 %. Der Unterschied dürfte teilweise auch darauf zurückgehen,<br />
dass die Teilfläche ohne Ansaat gelegentlich als Weg<br />
genutzt wird. Die Anzahl der Arten der Zielvegetation war<br />
in der angesäten Variante höher, jedoch dominierten in<br />
beiden Varianten sechs Jahre nach der Baumaßnahme die<br />
Zielarten der angrenzenden Feuchtheide. Im Ergebnis ist<br />
festzustellen, dass die Ansaat zwar zu höherer Deckung<br />
<strong>und</strong> zu einem etwas artenreicheren Bestand führte, die<br />
Fläche mit spontaner Selbstbegrünung aber inzwischen<br />
auch im Wesentlichen die Zielvegetation aufweist.<br />
lagebesprechung im moor am pfälzerkopf<br />
Dr. Pascal von Sengbusch erläutert Dr. Wolfgang Kramer vom Regierungspräsidium<br />
Freiburg die Baumaßnahmen. Im Bildvordergr<strong>und</strong> ein Stauwerk<br />
aus fünf Zentimetern starken Eichenbohlen in einem Graben.<br />
fazit<br />
Eine Stützung des Wasserhaushalts kann unter günstigen<br />
Rahmenbedingungen die Vegetationsentwicklung in<br />
Grinden mooren positiv beeinflussen <strong>und</strong> die Erhaltung<br />
der Bunten Torfmoosgesellschaft fördern. Ansaat mit geeignetem<br />
autochthonen Material beschleunigt auf feuchten<br />
Grinden flächen die Wiederbesiedlung nach Baumaßnahmen,<br />
jedoch ist auch die spontane Selbstbegrünung mittelfristig<br />
Erfolg versprechend.<br />
Quellen<br />
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE (HRSG.) (2006): LIFE-<br />
Projekt „Grindenschwarzwald“ – Abschlussbericht: www.rp.badenwuerttemberg.de/servlet/PB/show/1298082/rpk56_grin_abschlussbericht.pdf<br />
SENGBUSCH, P. VON (2005): Bericht zur Durchführung von<br />
Wiedervernässungs- <strong>und</strong> Pflegemaßnahmen in drei Mooren im<br />
Nordschwarzwald. – Unveröffentlicht, Werkvertrag im Auftrag des<br />
Regierungspräsidiums Freiburg.<br />
SCHACH, J. (2011): Erfolgskontrollen ausgewählter Landschaftspflegearbeiten<br />
– Bericht 2011. – Unveröffentlicht, Institut <strong>für</strong> Botanik <strong>und</strong><br />
Landschaftsk<strong>und</strong>e im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe.