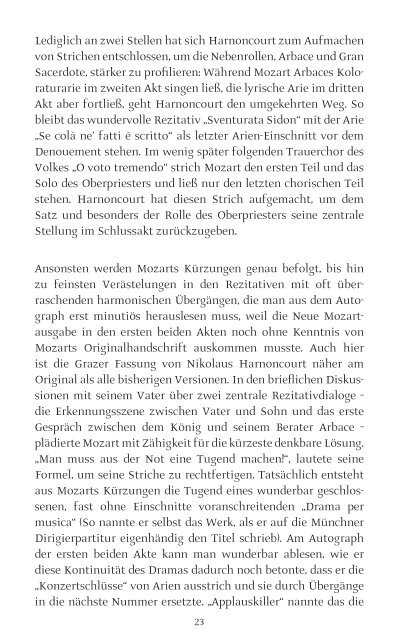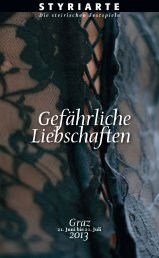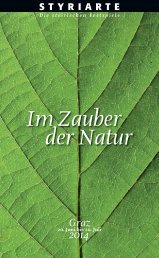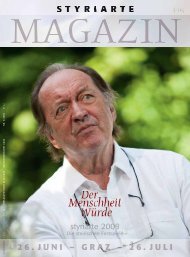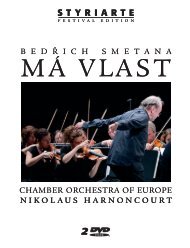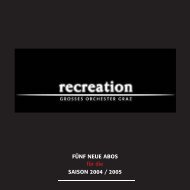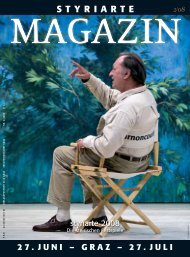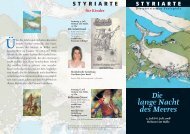Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lediglich an zwei Stellen hat sich Harnoncourt zum Aufmachen<br />
von Strichen entschlossen, um die Nebenrollen, Arbace und Gran<br />
Sacerdote, stärker zu profilieren: Während Mozart Arbaces Koloraturarie<br />
im zweiten Akt singen ließ, die lyrische Arie im dritten<br />
Akt aber fortließ, geht Harnoncourt den umgekehrten Weg. So<br />
bleibt das wundervolle Rezitativ „Sventurata Sidon“ mit der Arie<br />
„Se colà ne’ fatti è scritto“ als letzter Arien-Einschnitt vor dem<br />
Denouement stehen. Im wenig später folgenden Trauerchor des<br />
Volkes „O voto tremendo“ strich Mozart den ersten Teil und das<br />
Solo des Oberpriesters und ließ nur den letzten chorischen Teil<br />
stehen. Harnoncourt hat diesen Strich aufgemacht, um dem<br />
Satz und besonders der Rolle des Oberpriesters seine zentrale<br />
Stellung im Schlussakt zurückzugeben.<br />
Ansonsten werden Mozarts Kürzungen genau befolgt, bis hin<br />
zu feinsten Verästelungen in den Rezitativen mit oft überraschenden<br />
harmonischen Übergängen, die man aus dem Autograph<br />
erst minutiös herauslesen muss, weil die Neue Mozartausgabe<br />
in den ersten beiden Akten noch ohne Kenntnis von<br />
Mozarts Originalhandschrift auskommen musste. Auch hier<br />
ist die Grazer Fassung von Nikolaus Harnoncourt näher am<br />
Original als alle bisherigen Versionen. In den brieflichen Diskussionen<br />
mit seinem Vater über zwei zentrale Rezitativdialoge –<br />
die Erkennungsszene zwischen Vater und Sohn und das erste<br />
Gespräch zwischen dem König und seinem Berater Arbace –<br />
plädierte Mozart mit Zähigkeit für die kürzeste denkbare Lösung.<br />
„Man muss aus der Not eine Tugend machen!“, lautete seine<br />
Formel, um seine Striche zu rechtfertigen. Tatsächlich entsteht<br />
aus Mozarts Kürzungen die Tugend eines wunderbar geschlossenen,<br />
fast ohne Einschnitte voranschreitenden „Drama per<br />
musica“ (So nannte er selbst das Werk, als er auf die Münchner<br />
Dirigierpartitur eigenhändig den Titel schrieb). Am Autograph<br />
der ersten beiden Akte kann man wunderbar ablesen, wie er<br />
diese Kontinuität des Dramas dadurch noch betonte, dass er die<br />
„Konzertschlüsse“ von Arien ausstrich und sie durch Übergänge<br />
in die nächste Nummer ersetzte. „Applauskiller“ nannte das die<br />
23