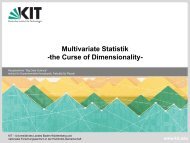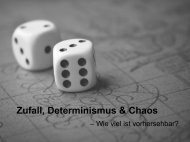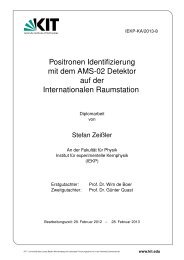IEKP-KA/2013-4 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
IEKP-KA/2013-4 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
IEKP-KA/2013-4 - Institut für Experimentelle Kernphysik - KIT
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Der LHC und das CMS-Experiment<br />
Dieses Kapitel beschreibt den Large Hadron Collider (LHC) und die wichtigsten damit verbundenen<br />
Experimente. Besonders das Experiment Compact Myon Solenoid (CMS) und<br />
dessen Spurdetektor werden vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Übersicht zu den<br />
Ausbauplänen des Spurdetektors <strong>für</strong> die Hochluminositätsphase des LHC.<br />
2.1. Der LHC<br />
Der LHC ist ein Hadronen-Speicherring, der in einem Tunnel mit 26,7 km Umfang am<br />
europäischen Kernforschungszentrum CERN errichtet worden ist. Der LHC wurde da<strong>für</strong><br />
ausgelegt, Proton-Proton-Kollisionen mit einer Schwerpunktenergie von bis zu 14 TeV erzeugen<br />
zu können. Dies wird erreicht, indem die Protonen in einer Beschleunigerkaskade<br />
und zuletzt im großen Hadronen-Speicherring auf gegenläufigen Bahnen jeweils auf bis<br />
zu 7 TeV beschleunigt werden, bevor sie in den Zentren der Experimente miteinander zur<br />
Kollision gebracht werden [EB08].<br />
Eine Übersicht über den Aufbau und die Anordnung der Experimente gibt Abbildung 2.1.<br />
2.1.1. Vorbeschleuniger<br />
Bevor Teilchen in den großen Speicherring des LHC gelangen, durchlaufen sie eine Kette<br />
aus verschiedenen Vorbeschleunigern. Quelle, soweit nicht anders angegeben: [Sch99].<br />
Am Anfang der Kette steht eine Gasflasche, aus welcher der Linearbeschleuniger Linac 2<br />
mit Wasserstoff befüllt wird. Nachdem dort die Elektronen der Atome durch Ionisation<br />
entfernt worden sind, werden die verbleibenden Protonen von einer Reihe hohlzylindrischer<br />
Elektroden beschleunigt. An dieser Wideröe-Struktur liegt hochfrequente Wechselspannung<br />
an, wodurch die Driftröhren elektrische Felder zur Beschleunigung der Protonen<br />
erzeugen können. Linac 2 beschleunigt die Protonen auf eine Energie von 50 MeV.<br />
Danach gelangen die Protonen in den Proton-Synchrotron-Booster. Die Protonen werden<br />
darin auf vier ringförmige Beschleunigungsstrecken mit einem Durchmesser von<br />
50 m aufgeteilt und von Hohlraumresonatoren auf eine Energie von 1,4 GeV beschleunigt.<br />
Dipolmagnete halten die Teilchen auf einer Kreisbahn.<br />
Die nächste Stufe in der Beschleunigerkette stellt das Proton-Synchrotron (PS) dar. Es<br />
gruppiert die Protonen aus dem Booster zu 72 Paketen. Die Teilchen werden von Hohlraumresonatoren<br />
auf 25 GeV (99,93 % der Lichtgeschwindigkeit) beschleunigt.<br />
3