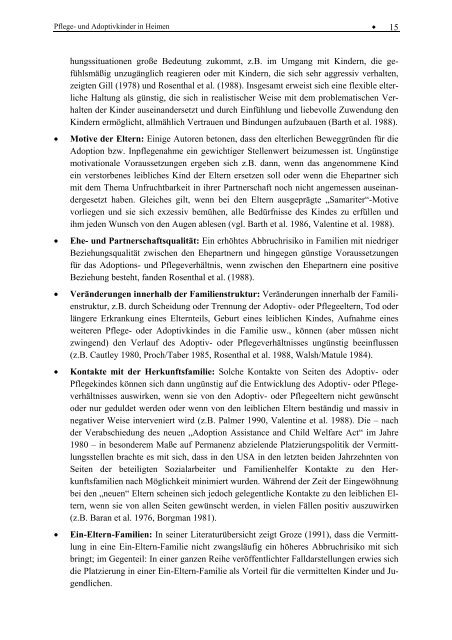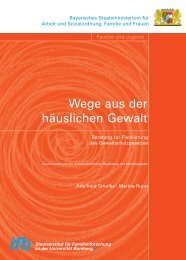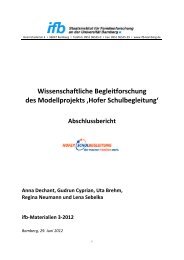Pflege- und Adoptivkinder in Heimen - ifb - Bayern
Pflege- und Adoptivkinder in Heimen - ifb - Bayern
Pflege- und Adoptivkinder in Heimen - ifb - Bayern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Pflege</strong>- <strong>und</strong> <strong>Adoptivk<strong>in</strong>der</strong> <strong>in</strong> <strong>Heimen</strong> 15<br />
hungssituationen große Bedeutung zukommt, z.B. im Umgang mit K<strong>in</strong>dern, die gefühlsmäßig<br />
unzugänglich reagieren oder mit K<strong>in</strong>dern, die sich sehr aggressiv verhalten,<br />
zeigten Gill (1978) <strong>und</strong> Rosenthal et al. (1988). Insgesamt erweist sich e<strong>in</strong>e flexible elterliche<br />
Haltung als günstig, die sich <strong>in</strong> realistischer Weise mit dem problematischen Verhalten<br />
der K<strong>in</strong>der ause<strong>in</strong>andersetzt <strong>und</strong> durch E<strong>in</strong>fühlung <strong>und</strong> liebevolle Zuwendung den<br />
K<strong>in</strong>dern ermöglicht, allmählich Vertrauen <strong>und</strong> B<strong>in</strong>dungen aufzubauen (Barth et al. 1988).<br />
• Motive der Eltern: E<strong>in</strong>ige Autoren betonen, dass den elterlichen Beweggründen für die<br />
Adoption bzw. Inpflegenahme e<strong>in</strong> gewichtiger Stellenwert beizumessen ist. Ungünstige<br />
motivationale Voraussetzungen ergeben sich z.B. dann, wenn das angenommene K<strong>in</strong>d<br />
e<strong>in</strong> verstorbenes leibliches K<strong>in</strong>d der Eltern ersetzen soll oder wenn die Ehepartner sich<br />
mit dem Thema Unfruchtbarkeit <strong>in</strong> ihrer Partnerschaft noch nicht angemessen ause<strong>in</strong>andergesetzt<br />
haben. Gleiches gilt, wenn bei den Eltern ausgeprägte „Samariter“-Motive<br />
vorliegen <strong>und</strong> sie sich exzessiv bemühen, alle Bedürfnisse des K<strong>in</strong>des zu erfüllen <strong>und</strong><br />
ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen (vgl. Barth et al. 1986, Valent<strong>in</strong>e et al. 1988).<br />
• Ehe- <strong>und</strong> Partnerschaftsqualität: E<strong>in</strong> erhöhtes Abbruchrisiko <strong>in</strong> Familien mit niedriger<br />
Beziehungsqualität zwischen den Ehepartnern <strong>und</strong> h<strong>in</strong>gegen günstige Voraussetzungen<br />
für das Adoptions- <strong>und</strong> <strong>Pflege</strong>verhältnis, wenn zwischen den Ehepartnern e<strong>in</strong>e positive<br />
Beziehung besteht, fanden Rosenthal et al. (1988).<br />
• Veränderungen <strong>in</strong>nerhalb der Familienstruktur: Veränderungen <strong>in</strong>nerhalb der Familienstruktur,<br />
z.B. durch Scheidung oder Trennung der Adoptiv- oder <strong>Pflege</strong>eltern, Tod oder<br />
längere Erkrankung e<strong>in</strong>es Elternteils, Geburt e<strong>in</strong>es leiblichen K<strong>in</strong>des, Aufnahme e<strong>in</strong>es<br />
weiteren <strong>Pflege</strong>- oder Adoptivk<strong>in</strong>des <strong>in</strong> die Familie usw., können (aber müssen nicht<br />
zw<strong>in</strong>gend) den Verlauf des Adoptiv- oder <strong>Pflege</strong>verhältnisses ungünstig bee<strong>in</strong>flussen<br />
(z.B. Cautley 1980, Proch/Taber 1985, Rosenthal et al. 1988, Walsh/Matule 1984).<br />
• Kontakte mit der Herkunftsfamilie: Solche Kontakte von Seiten des Adoptiv- oder<br />
<strong>Pflege</strong>k<strong>in</strong>des können sich dann ungünstig auf die Entwicklung des Adoptiv- oder <strong>Pflege</strong>verhältnisses<br />
auswirken, wenn sie von den Adoptiv- oder <strong>Pflege</strong>eltern nicht gewünscht<br />
oder nur geduldet werden oder wenn von den leiblichen Eltern beständig <strong>und</strong> massiv <strong>in</strong><br />
negativer Weise <strong>in</strong>terveniert wird (z.B. Palmer 1990, Valent<strong>in</strong>e et al. 1988). Die – nach<br />
der Verabschiedung des neuen „Adoption Assistance and Child Welfare Act“ im Jahre<br />
1980 – <strong>in</strong> besonderem Maße auf Permanenz abzielende Platzierungspolitik der Vermittlungsstellen<br />
brachte es mit sich, dass <strong>in</strong> den USA <strong>in</strong> den letzten beiden Jahrzehnten von<br />
Seiten der beteiligten Sozialarbeiter <strong>und</strong> Familienhelfer Kontakte zu den Herkunftsfamilien<br />
nach Möglichkeit m<strong>in</strong>imiert wurden. Während der Zeit der E<strong>in</strong>gewöhnung<br />
bei den „neuen“ Eltern sche<strong>in</strong>en sich jedoch gelegentliche Kontakte zu den leiblichen Eltern,<br />
wenn sie von allen Seiten gewünscht werden, <strong>in</strong> vielen Fällen positiv auszuwirken<br />
(z.B. Baran et al. 1976, Borgman 1981).<br />
• E<strong>in</strong>-Eltern-Familien: In se<strong>in</strong>er Literaturübersicht zeigt Groze (1991), dass die Vermittlung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>-Eltern-Familie nicht zwangsläufig e<strong>in</strong> höheres Abbruchrisiko mit sich<br />
br<strong>in</strong>gt; im Gegenteil: In e<strong>in</strong>er ganzen Reihe veröffentlichter Falldarstellungen erwies sich<br />
die Platzierung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>-Eltern-Familie als Vorteil für die vermittelten K<strong>in</strong>der <strong>und</strong> Jugendlichen.