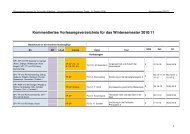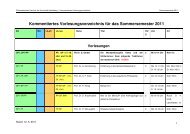KVV SS 2013 (pdf) - Philosophisches Seminar - Uni.hd.de
KVV SS 2013 (pdf) - Philosophisches Seminar - Uni.hd.de
KVV SS 2013 (pdf) - Philosophisches Seminar - Uni.hd.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Wie ist es zu diesem Be<strong>de</strong>utungswan<strong>de</strong>l gekommen? Diese Frage wollen wir anhand<br />
ausgewählter Texte zur Ethik und Moralphilosophie (Aristoteles, Hume, Kant, Mill) erörtern.<br />
Das Ziel <strong>de</strong>s <strong>Seminar</strong>s wird darin liegen, im Rückgriff auf historische Positionen,<br />
aber mit Blick auf die gegenwärtige Diskussionslage, in Grundfragen und –probleme <strong>de</strong>r<br />
philosophischen Ethik einzuführen. Der genaue Semesterfahrplan sowie <strong>de</strong>r zu behan<strong>de</strong>ln<strong>de</strong><br />
Textkorpus wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r 1. Sitzung festgelegt.<br />
Literatur:<br />
Aristoteles, Nikomachische Ethik (Reclam 8586)<br />
Immanuel Kant, Kritik <strong>de</strong>r praktischen Vernunft (Reclam 1111)<br />
Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik <strong>de</strong>r Sitten (Reclam 4507)<br />
David Hume, Eine Untersuchung über die Prinzipien <strong>de</strong>r Moral (Enquiry concerning the<br />
Principles of Morals) (Reclam 8231)<br />
J. Stuart Mill, Der Utilitarismus (Reclam 9821)<br />
Dr. Miriam<br />
Wil<strong>de</strong>nauer<br />
Das Programm von<br />
Hegels Phänomenologie<br />
<strong>de</strong>s Geistes und<br />
<strong>de</strong>ssen ersten bei<strong>de</strong>n<br />
Durchführungsschritten<br />
2 Di 12 -14 Hegelsaal<br />
Ziel <strong>de</strong>r Phänomenologie <strong>de</strong>r Geistes (P<strong>hd</strong>G) ist es, die Kluft zwischen vorwissenschaftlichen<br />
Überzeugungen <strong>de</strong>r Menschen als einzelnen („natürliches Bewusstsein“) o<strong>de</strong>r<br />
menschlicher Gemeinschaften („Geist“) einerseits und <strong>de</strong>n Wahrheiten <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen<br />
Wissenschaften philosophisch zu überwin<strong>de</strong>n. Dazu wer<strong>de</strong>n Erfahrungen <strong>de</strong>s Scheiterns<br />
vorwissenschaftlicher, aber auf Wissen zielen<strong>de</strong>r Einstellungen dargestellt. Als<br />
Grund <strong>de</strong>s Scheiterns erweist sich ein allen thematisierten Gestalten zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>r<br />
Kontrast zwischen <strong>de</strong>r eigenen Subjektivität und einer von ihr als unabhängig gesetzten<br />
Objektivität. Unter Voraussetzung dieses Kontrastes könne we<strong>de</strong>r theoretisches<br />
Wissen noch praktische Einsicht erreicht wer<strong>de</strong>n. So soll zum Beispiel das erste Kapitel<br />
„Die sinnliche Gewissheit“ zeigen, dass ein unmittelbares Wissen von Gegenstän<strong>de</strong>n allein<br />
mittels in<strong>de</strong>xikalischer Bezugnahmen („ich“, „hier“, „jetzt“) auf sie nicht möglich ist.<br />
Entschei<strong>de</strong>nd für <strong>de</strong>n potentiellen Erfolg <strong>de</strong>r P<strong>hd</strong>G ist es, dass das jeweilige Scheitern<br />
aus <strong>de</strong>r Binnenperspektive <strong>de</strong>s vor-wissenschaftlichen Bewusstseins erfahren wer<strong>de</strong>n<br />
kann. Aufgabe eines diese Erfahrungen <strong>de</strong>s Bewusstseins betrachten<strong>de</strong> Denkens<br />
(„wir“) sei es lediglich, <strong>de</strong>n Kern dieser Erfahrung begrifflich zu erfassen, da <strong>de</strong>r betrachteten<br />
Gestalt selbst die dazu nötigen Mittel fehlten. Deshalb schließt sich an je<strong>de</strong>n<br />
ersten Schritt einer Selbsterfahrung ein zweiter Schritt an, in <strong>de</strong>m „wir“ neue Begriffe ins<br />
Verfahren einführen, durch die das Scheitern <strong>de</strong>s soeben thematischen natürlichen Bewusstseins<br />
zumin<strong>de</strong>st partiell erkannt wer<strong>de</strong>n kann. Diese neu eingeführten Begriffe<br />
wer<strong>de</strong>n dann von einer neuen Bewusstseinsgestalt genutzt, um die von ihr intendierten<br />
Erkenntnisse zu erreichen. Durch dieses Verfahren versucht Hegel zu zeigen, dass 1.<br />
das vor-wissenschaftliche Bewusstsein sich in endlich vielen Schritten zu <strong>de</strong>r epistemischen<br />
Einstellung erheben kann, die für eine wissenschaftliche Selbst- und Welterkenntnis<br />
nötig ist und dass 2. dazu <strong>de</strong>r basale, das vor-wissenschaftliche Bewusstsein<br />
konstituieren<strong>de</strong> Kontrast zwischen Subjektivität und Objektivität zu überwin<strong>de</strong>n ist. Den<br />
– unentwickelten – Begriff einer solchen epistemischen Einstellung bezeichnet Hegel<br />
mit <strong>de</strong>m Ausdruck „absolute Wissen“. Er schließt das phänomenologische Verfahren<br />
ab.<br />
In diesem ersten Teil <strong>de</strong>s einjährigen Interpretationskurses (P3 und GP4) wer<strong>de</strong>n wir intensiv<br />
die Einleitung in Hegels Phänomenologie <strong>de</strong>s Geistes (1807) und die ersten bei<strong>de</strong>n<br />
Kapitel textnah studieren.<br />
Teilnahmeempfehlung: Anmeldung in moodle ( http://elearning2.uni-hei<strong>de</strong>lberg.<strong>de</strong>/ ).<br />
45