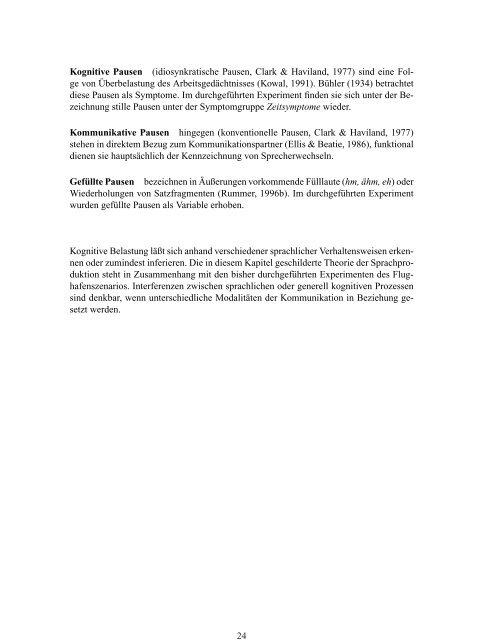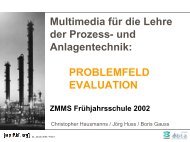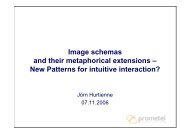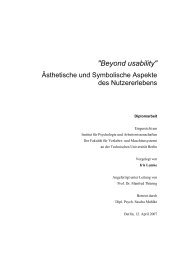Auswirkungen von Ablenkung durch gehörte Sprache und eigene ...
Auswirkungen von Ablenkung durch gehörte Sprache und eigene ...
Auswirkungen von Ablenkung durch gehörte Sprache und eigene ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
24<br />
Kognitive Pausen (idiosynkratische Pausen, Clark & Haviland, 1977) sind eine Folge<br />
<strong>von</strong> Überbelastung des Arbeitsgedächtnisses (Kowal, 1991). Bühler (1934) betrachtet<br />
diese Pausen als Symptome. Im <strong>durch</strong>geführten Experiment finden sie sich unter der Bezeichnung<br />
stille Pausen unter der Symptomgruppe Zeitsymptome wieder.<br />
Kommunikative Pausen hingegen (konventionelle Pausen, Clark & Haviland, 1977)<br />
stehen in direktem Bezug zum Kommunikationspartner (Ellis & Beatie, 1986), funktional<br />
dienen sie hauptsächlich der Kennzeichnung <strong>von</strong> Sprecherwechseln.<br />
Gefüllte Pausen bezeichnen in Äußerungen vorkommende Fülllaute (hm, ähm, eh) oder<br />
Wiederholungen <strong>von</strong> Satzfragmenten (Rummer, 1996b). Im <strong>durch</strong>geführten Experiment<br />
wurden gefüllte Pausen als Variable erhoben.<br />
Kognitive Belastung läßt sich anhand verschiedener sprachlicher Verhaltensweisen erkennen<br />
oder zumindest inferieren. Die in diesem Kapitel geschilderte Theorie der Sprachproduktion<br />
steht in Zusammenhang mit den bisher <strong>durch</strong>geführten Experimenten des Flughafenszenarios.<br />
Interferenzen zwischen sprachlichen oder generell kognitiven Prozessen<br />
sind denkbar, wenn unterschiedliche Modalitäten der Kommunikation in Beziehung gesetzt<br />
werden.