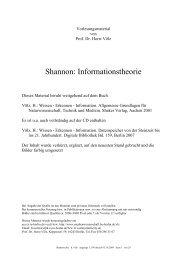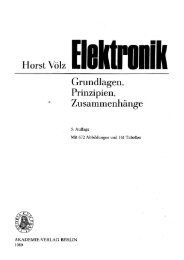Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1840, 1902). Der deutsche Illustrator der Goethezeit, D. Chodowiecki, <strong>ist</strong> zugleich politischer Karikatur<strong>ist</strong>; in der 2. Hälfte<br />
des 19. Jahrhunderts arbeitet W. Scholz für den »Kladderadatsch«, A. Oberländer für die »Fliegenden Blätter«. W. Buschs<br />
Bildgeschichten zeigen karikatur<strong>ist</strong>ische Elemente. Am Beginn des 20. Jahrhunderts stehen die gesellschaftskritischen<br />
Karikaturen von K. Arnold, R. Blix (* 1882, 1958), O. Gulbransson, T. T. Heine, E. Thöny u. a. (alle im »Simplicissimus«).<br />
In der Weimarer Republik erheben H. Zille, K. Kollwitz, G. Grosz, O. Dix mit expression<strong>ist</strong>ischen Karikaturen soziale<br />
Anklage. A. Kubin und A. P. Weber zeichnen apokalyptische Karikaturen. Heute <strong>ist</strong> die politische Karikatur v. a. in<br />
Zeitungen und Zeitschriften, die fantastische und komische Karikatur auch durch Anthologien (häufig unter dem Begriff<br />
Cartoon) verbreitet. Schule bildend für einen rein aus der grafischen Linie wirksamen Karikaturstil wurde S. Steinberg.<br />
Weitere bekannte zeitgenössische Karikatur<strong>ist</strong>en sind u. a. C. Addams, Bosc, Chaval, J. Effel, R. Peynet, R. Searle, Sempé,<br />
Siné, T. Ungerer, P. Flora, K. Halbritter, H. E. Köhler, E. M. Lang, Loriot, F. K. Waechter, R. Topor, H. Traxler, Frans de<br />
Boer (efbé), Marie Marcks, D. Levine.<br />
Epigramm und Satire: Weisheit, Witz, Kritik<br />
Das Epigramm <strong>ist</strong> eine uralte griechische literarische Form. Ursprünglich war es eine »Aufschrift« auf einem Stein, als Weih-<br />
, Grab- oder Ehreninschrift; die Aussagen mussten auf kleinem Raum untergebracht werden; von daher hat das Epigramm die<br />
Tendenz zur Kürze und Prägnanz, aus der sich bald die witzige Pointe entwickelte. Zur besseren Einprägung waren die<br />
Epigramme im allgemeinen in Versen abgefasst, und hier setzte sich das elegische D<strong>ist</strong>ichon immer mehr durch. Seit dem<br />
Hellenismus bis in die byzantinische Zeit schrieb man literarische Epigramme auch für Bücher; als Themen kamen jetzt das<br />
Erotische, Menschentypen und das Symposion (Gastmahl) hinzu; Epigramme wurden in stets wachsenden Sammlungen<br />
zusammengestellt; sie sind letzten Endes in die großen Sammlungen der Anthologia Palatina (980 n. Chr.) und Anthologia<br />
Planudea (1299 n. Chr.) eingegangen und dort überliefert.<br />
In Rom <strong>ist</strong> als Epigrammdichter besonders zur Zeit des Kaisers Domitian Martial aus Bilbilis in Spanien hervorgetreten. Die<br />
Palette der Inhalte Martials <strong>ist</strong> sehr reich: Wir finden die herkömmlichen Weihe-, Grab-, Symposions- und Liebesgedichte,<br />
allerdings nicht selten in entstellter Form; so erscheint bei ihm die übliche Bitte, einem Toten solle die Erde leicht sein, bei<br />
einer Kupplerin mit dem Zusatz »damit die Hunde ja deine Knochen ausscharren können« kam es ihm doch sehr auf die<br />
Pointe an. Er lobte Domitian wie auch <strong>seine</strong> Freunde und Gönner. Seinem erbarmumgslosen Spott <strong>ist</strong> die großstädtische<br />
Gesellschaft im Rom <strong>seine</strong>r Zeit ausgesetzt. Er zielte auf alle Formen menschlichen Fehlverhaltens, aber auch auf körperliche<br />
Gebrechen und soziale Erbärmlichkeit, wie sie etwa schäbiges Umzugsgut samt einem rinnenden Nachttopf verrät. Durch<br />
<strong>seine</strong> Epigramme, sagt er, »soll das Leben (Roms) <strong>seine</strong> eigenen Sitten er<strong>kennen</strong>«. Wo er der Frage nach den Werten im<br />
menschlichen Leben nachgeht, tritt sein Epikureismus zutage. In dieselbe Zeit dürften die »Priapea«, eine Sammlung von<br />
Epigrammen, anzusetzen sein; in ihr deutet der Gartengott Priapus das menschliche Treiben aus <strong>seine</strong>r phallischen, Kraft und<br />
Fruchtbarkeit symbolisierenden Sicht.<br />
Die Satire <strong>ist</strong> eine literarische Form, die ganz den Römern gehört, sagt voller Stolz Quintilian, Professor der Rhetorik am<br />
Ende des 1. Jahrhunderts n.Chr., im 10. Buch <strong>seine</strong>s Lehrbuches der Beredsamkeit, der »Institutio oratoria«. Die Satire hat<br />
zwar dem Epigramm verwandte Inhalte, aber doch einen anderen, weiteren Themenbereich. Sie <strong>ist</strong> nicht vom Satyrspiel<br />
herzuleiten, das als Burleske den attischen Tragödien folgte, sondern von »Satura«, einer römischen Speise mit vielen<br />
Ingredienzien, bietet also »vermischte Betrachtungen«. Schon Ennius hat »Saturae« geschrieben; eine Vorstellung können<br />
wir uns erst von denen des Lucilius machen; von <strong>seine</strong>n an die 30 Büchern sind allerdings <strong>nur</strong> Fragmente erhalten. Nach der<br />
Verwendung anderer Metren blieb er dann beim Hexameter, der seitdem mit der römischen Satire verbunden <strong>ist</strong>. Lucilius hat<br />
das römische Leben auf der Suche nach Orientierung selbstständig kritisch durchleuchtet, nahm zu sexuellen Fragen, zu<br />
Politik, Literatur, Philosophie und Religion als ein aufgeklärter Gebildeter Stellung, der dem Scipionenkreis nahe stand; er<br />
scheute sich aber auch nicht, Personen namentlich anzugreifen. Von der »Satura Menippea« des gelehrten Varro aus Reate im<br />
Sabinerland <strong>ist</strong> uns wenig erhalten. Er hat nach dem Vorbild des Menippos von Gadara, der nach 300 v. Chr. starb, das<br />
Prosimetrum, die Mischung aus Prosa und Dichtung, in die römische Literatur eingeführt.<br />
Dem Lucilius folgt in kritischer D<strong>ist</strong>anz Horaz in <strong>seine</strong>r Satirendichtung in zwei Büchern, die bei ihm die Bezeichnung<br />
»Sermones« (»Gespräche«) tragen. In ihnen greift er niemanden persönlich an. Er lässt uns an vielen Situationen <strong>seine</strong>s<br />
Lebens teilnehmen, schildert sie mit freundlicher, auch schalkhafter Kritik, stellt uns nicht selten vor die Frage einer<br />
Bewertung, sagt uns aber auch, wie und warum er sich so und nicht anders entschieden hat. Der Plauderton, in dem die<br />
Gedichte bewusst gehalten sind, täuscht nicht über den Ernst der Frage nach der Lebensführung hinweg. Man kann zu den<br />
»Sermones« die zwei in Hexametern verfassten Bücher »Ep<strong>ist</strong>eln« aus einer viel späteren Schaffensperiode des Horaz<br />
stellen; in ihrem ersten Buch geht es auch um die Fragen der Lebensgestaltung, das zweite <strong>ist</strong> ganz Horazens Reflexionen<br />
über die Dichtkunst gewidmet. Von Persius haben wir sechs Satiren, in denen er sich wie Horaz von Lucilius absetzt, aber<br />
noch stärker das philosophische, stoische Element wirksam sein lässt. Seine feinsinnig-schwierigen Gedichte wurden von den<br />
Zeitgenossen sehr bewundert.<br />
Der Dichter, der die moderne Auffassung von Satire am stärksten geprägt hat, <strong>ist</strong> Juvenal; er verfasste Satiren nach 100 n.<br />
Chr. in <strong>seine</strong>r zweiten Lebenshälfte. Im Gegensatz zum feinsinnigen Persius <strong>ist</strong> er ein radikaler Moral<strong>ist</strong> mit grimmigem<br />
<strong>Humor</strong>. Ihn macht, wie er sagt, die Entrüstung zum Dichter. Unermüdlich und ohne Differenzierung geißelt er in <strong>seine</strong>n 16<br />
Satiren die Laster Roms vor allem in der Oberschicht, malt ihr Fehlverhalten mit groben Zügen wie zum Beispiel das der<br />
Messalina, der Gemahlin des Kaisers Claudius, wie sie sich nachts ins Bordell schlich, um sich dort hinzugeben; als letzte<br />
verließ sie ihre Kammer, erschöpft von den Männern, doch nicht gesättigt. Immerhin findet Juvenal an anderer Stelle auch für<br />
die zermürbende Tätigkeit des Redelehrers Worte: »Der immer wieder durchgekaute Kohl bringt die armen Lehrer um.«<br />
Seine erstaunliche rhetorische Fähigkeit nähert viele <strong>seine</strong>r Satiren der kynisch-stoischen Sittenpredigt an. Er erfreute sich in<br />
der Spätantike und im Mittelalter großer Beliebtheit.<br />
Prof. Dr. Hans Armin Gärtner/Dr. Helga Gärtner<br />
Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung<br />
<strong>Dies</strong> <strong>ist</strong> der Titel eines Theaterstücks von Chr<strong>ist</strong>ian Dietrich Grabbe (1801 1836). In diesem Lustspiel setzt sich der Autor<br />
ironisch mit der Literatur und dem Ge<strong>ist</strong>esleben <strong>seine</strong>r Zeit auseinander. Heute wird der Titel gewöhnlich zitiert, wenn<br />
<strong>Humor</strong>.doc angelegt 21.2.02 aktuell 04.08.02 Seite 19/68