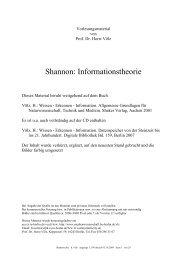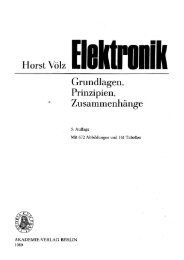Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Professor Kaluza in Göttingen warnte <strong>seine</strong> Studenten oft vor den Gefahren des doppelten Grenzüberganges und ermahnte<br />
sie, damit vorsichtig umzugehen. Er machte dies an folgendem Beispiel klar: Ein Mann kommt mit Magenbeschwerden zum<br />
Arzt. Der Arzt untersucht ihn gründlich und sagt dann: Sie müssen öfter essen, aber dabei weniger! Der Mann wollte es<br />
besonders gut machen und führte einen doppelten Grenzübergang aus: Er aß von nun an immer nichts!<br />
Ein Prof. erzählte:<br />
Vor Jahren hielt ich eine Anfängervorlesung und begann, wie es sich gehört, mit Logik. Zunächst erklärte ich, was man unter<br />
einer "Aussage" versteht:<br />
Eine Aussage <strong>ist</strong> ein Text, dessen Inhalt entweder wahr oder falsch <strong>ist</strong>. Als Beispiel nannte ich den Satz: Karl <strong>ist</strong> krank.<br />
In diesem Augenblick fiel mir siedendheiss ein, dass ich unbedingt einen lebenden Menschen namens "Karl" brauchte, auf<br />
den sich der Satz bezog. Andernfalls konnte man den Satz weder als wahr noch als falsch bezeichnen, d.h. er war gar keine<br />
Aussage.<br />
Um den Schaden schnell wieder gut zu machen, fragte ich in den Saal: Ist jemand unter Ihnen, der Karl heißt?<br />
Sekundenlange Stille! Dann eine Stimme aus dem Hintergrund: Der <strong>ist</strong> krank!<br />
Anatomie des Lachens [27.02.2001]<br />
Biologie, Die bunte Welt der Forschung, Psychologie<br />
Wer über eine Witz lacht, macht sich wahrscheinlich wenig Gedanken, welche <strong>seine</strong>r Hirnregionen gerade aktiv sind. Doch<br />
dafür gibt es ja Wissenschaftler, die der Sache auf den Grund gehen. Sie entdeckten, dass je nach Witz-Typ zunächst<br />
verschiedene Hirnareale aktiviert werden. Doch sobald der Witz als solcher erkannt wird, dann regt sich immer die gleiche<br />
Hirnregion - und zwar genau die, die auch bei Belohnungen aktiv wird.<br />
Jetzt zur Karnevalszeit kursieren sie wieder, die mehr oder weniger witzigen Kalauer wie: "Was bedeutet auf finnisch<br />
Sonnenuntergang? - Hell sinki." oder: "Steht ein Schwein vor der Steckdose und fragt: 'Wer hat dich denn hier<br />
eingemauert?'" Wer sich darüber nicht amüsieren sollte, kann sich zumindest wissenschaftlich damit auseinandersetzen. <strong>Dies</strong><br />
beginnt me<strong>ist</strong> mit einer groben Einteilung: Phonetische Witze wie die Frage nach dem Sonnenuntergang beruhen auf<br />
phonetischen Wortspielen, während der Schweinegag zur Kategorie der semantischen Witze gehört, die mit<br />
Wortbedeutungen spielen. Doch welcher Teil <strong>unser</strong>es Hirns arbeitet, wenn es sich amüsiert, und spiegelt sich hier auch die<br />
Witztypisierung wider?<br />
Das fragten sich Vinod Goel und Raymond Dolan vom Wellcome Department of Cognitive Neurology des Londoner<br />
Institute of Neurology. Sie erzählten ihren 14 Versuchspersonen semantische und phonetische Witze und beobachteten über<br />
Magnetresonanz-Spektroskopie, welche Hirnareale sich regten.<br />
Hörten die Probanden einen semantischen Witz, dann waren bestimmte Bereiche im hinteren Temporallappen der<br />
Großhirnrinde aktiv, die auch für das Wortverständnis zuständig sind. Amüsierten sie sich dagegen über einen phonetischen<br />
Scherz, dann feuerten zunächst die Nervenzellen des linken inferioren präfrontalen Cortex sowie der so genannten Insel, die<br />
auf der Grenze zwischen Frontal- und Temporallappen liegt. <strong>Dies</strong>e Areale verarbeiten auch Klänge und Geräusche.<br />
<strong>Dies</strong>e Hirnregionen waren jedoch nicht aktiv, wenn die Wissenschaftler die Pointe zerstörten, indem sie beispielsweise das<br />
wirkliche finnische Wort für "Sonnenuntergang" nannten. Andererseits gab es <strong>nur</strong> eine Hirnregion, die auf einen<br />
verstandenen Witz reagierte. Egal ob semantisch oder phonetisch, der mediane ventrale präfrontale Cortex arbeitete, sobald<br />
die Versuchspersonen schmunzelten. "Unabhängig von der Art des Witzes <strong>ist</strong> das gleiche System betroffen", erklärt Dolan.<br />
Interessanterweise arbeitet diese "<strong>Humor</strong>region" auch bei anderen angenehmen Gefühlen, wie nach Erhalt einer Belohnung.<br />
Offensichtlich scheint sich das Gehirn selbst zu belohnen, indem es sich über einen Witz amüsiert. Daher <strong>ist</strong> Lachen gesund,<br />
glaubt Dolan und betont: "Für manche Leute <strong>ist</strong> es fast wie eine Droge."<br />
Andreas Jahn<br />
Lachen Lexikon der Neurowissenschaft<br />
E laughter, aus der Sicht der Humanethologie ein mimisch-akustisches soziales Signal des Menschen. Lachen steht im<br />
Dienste verschiedener Bereitschaften, z.B. der Kontakt-, Spiel-, Aggressions- oder Fluchtbereitschaft, und <strong>ist</strong> damit ein<br />
Mehrzweckverhalten ( siehe Abb. ). Es hat <strong>seine</strong>n phylogenetischen Ursprung im "entspannten Mund-offen-Gesicht", ein<br />
häufig bei jungen Primaten zu beobachtendes Spielsignal, aber auch im "Furchtgrinsen", welches vor allem auch in der<br />
Evolution des Lächelns eine Rolle gespielt hat. Eine Funktion des Lachens <strong>ist</strong> die Solidarisierung des Gruppenverbandes<br />
gegen Außenseiter durch das gemeinsame Auslachen. Die jeweilige Bedeutung kann jedoch <strong>nur</strong> durch zusätzliche<br />
Metasignale erschlossen werden. Lachen selbst <strong>ist</strong> wiederum auch ein Metasignal zur Charakterisierung sprachlicher<br />
Äußerungen (Sprache), Körperhaltungen und Bewegungen. - In bestimmten psychopathologischen Situationen kann das<br />
Lachen versetzt zur eigenen Befindlichkeit auftreten, wie etwa beim Zwangslachen (Risus sardonicus) u.a. Da dem Lachen<br />
neben der kommunikativen (Kommunikation) offenbar auch eine "expressiv entladende" Komponente beizumessen <strong>ist</strong> und<br />
diese in bestimmten Situationen sogar dominierend sein kann, fehlt bislang eine beide Aspekte befriedigend erklärende<br />
Hypothese für dessen Entstehung. Neurobiologisch <strong>ist</strong> eine Beteiligung mehrerer funktionaler zentralnervöser Strukturen<br />
anzunehmen, die auf die "Lachmotorik" projizieren. Mimik.<br />
Der hintere obere Bereich des Frontallappens spielt beim Lächeln und Lachen eine entscheidende Rolle. Die elektrische<br />
Stimulation des vorderen Teils des supplementär-motorischen Areals führte immer zu einem Zustand der Heiterkeit und, je<br />
nach Stärke der Stromstöße, zu einem Lächeln oder Lachen. Derart gereizte Versuchspersonen erleben dies aber nicht als<br />
fremdbestimmt (Willensfreiheit, Zwangslachen), sondern als echten Ausdruck von Heiterkeit. - Auch das "Schlapplachen"<br />
hat neuronale Ursachen: Die Beine können beim intensiven Lachen schwach werden, weil die Reizleitung in den Beinnerven<br />
kurzzeitig eingeschränkt wird und ein Muskelreflex im Unterschenkel in Gang kommt.<br />
Lachen Schematisierte und vereinfachte Darstellung der verschiedenen Funktionen (Funktionsvielfalt) des<br />
Mehrzweckverhaltens "Lachen".<br />
Copyright Spektrum Akademischer Verlag<br />
<strong>Humor</strong>.doc angelegt 21.2.02 aktuell 04.08.02 Seite 41/68