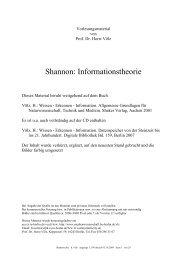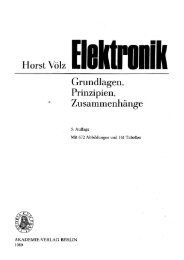Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Humor - Dies ist unser Püffki, nur Eingeweihte kennen seine hohen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sitten, dienstbar zu machen. Ganz in Krügers Sinne, dass der Harlekin als »Naturmensch« sein dramatisches Ex<strong>ist</strong>enzrecht<br />
verdiene, plädiert schließlich Justus Möser in <strong>seine</strong>r Schrift über 'Harlekin oder Vertheidigung des Grotesk-Komischen' (in<br />
zweiter Auflage 1777). Während er hier für die Harlekinade eigene »Regeln und Vollkommenheiten« postuliert, räumt er<br />
dem Zeitgeschmack immerhin die Konzession ein, das Lachen, das die komische Person auslöst, sei wo immer möglich zu<br />
verbinden mit einer Bloßstellung der das Gelächter erregenden Laster und dadurch, indirekt, mit dem angestrebten sittlichen<br />
Läuterungseffekt. Erst zu Anfang des kommenden Jahrhunderts wird der Hanswurst wieder von allen an ihn herangetragenen<br />
moralischen Anforderungen befreit: Siegfried August Mahlmann ('Ein paar Worte über die Einführung des Hanswursts auf<br />
der Bühne' und 'Vorschläge zur Emporbringung des deutschen Theaters') gesteht <strong>seine</strong>m »komischen Genie« ein vollständig<br />
autarkes Recht des Lachens zu, das für eine Nation, die nicht zu einer arbeitsbesessenen, stumpfen »Herde Biber«<br />
herabsinken wolle, eine unabdingbare Notwendigkeit darstelle.<br />
Literatur: K. v. Görner, Der Hans Wurst-Streit in Wien und Joseph von Sonnenfels. Wien 1884; F. Raab, J. J. Felix von Kurz<br />
genannt Bernardon. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Theaters im XVIII. Jahrhundert. Frankfurt a.M. 1899; U.<br />
Birbaumer. Das Werk des J. Felix von Kurz- Bernardon und <strong>seine</strong> szenische Realisierung. Versuch einer Genealogie und<br />
Dramaturgie der Bernardoniade. Zwei Bände. Wien 1971; H. G. Asper, Hanswurst. Studien zum Lustigmacher auf der<br />
Berufsschauspielerbühne in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Emsdetten 1980; A. Ziltener, Hanswursts Lachende<br />
Erben. Zum Weiterleben der lustigen Person im Wiener Vorstadt- Theater von La Roche bis Raimund. Bern, Frankfurt a.M.<br />
New York, Paris 1989.<br />
Kulturgeschichte Bremmer<br />
Vorwort<br />
Erst in jüngerer Zeit haben H<strong>ist</strong>oriker dem <strong>Humor</strong> als einem Schlüssel zu den kulturellen Codes und der kulturellen<br />
Sensibilität der Vergangenheit erkannt und ihrerseits für <strong>Humor</strong> interessiert.<br />
Jan Bremmer; Herman Roodenburg: <strong>Humor</strong> und Geschichte: Eine Einführung<br />
S. 9: Was <strong>ist</strong> <strong>Humor</strong>? Im Titel dieses Buches benutzen wir den Begriff im allgemeinsten und neutralsten Sinne, um eine<br />
ganze Vielfalt an Verhaltensweisen abzudecken: Vom Ausspruch zum Versprecher, vom Streich zum Wortspiel, von der<br />
Farce zur Albernheit. Anders gesagt: Wir sehen <strong>Humor</strong> als jede durch eine Handlung, durch Sprechen, durch Schreiben,<br />
durch Bilder oder durch Musik übertragene Botschaft, die darauf abzielt, ein Lächeln oder ein Lachen hervorzurufen. <strong>Dies</strong>e<br />
Definition erlaubt uns nicht <strong>nur</strong>, <strong>unser</strong>e Untersuchungen auf die Antike, das Mittelalter und die frühe Neuzeit auszudehnen,<br />
sondern auch, interessante Fragen an Kulturh<strong>ist</strong>oriker zu stellen: Wer überträgt welchen <strong>Humor</strong> in welcher Weise an wen, wo<br />
und wann?<br />
Der Begriff „<strong>Humor</strong>“ <strong>ist</strong> - streng genommen - recht jung. In <strong>seine</strong>r modernen Bedeutung <strong>ist</strong> er in England erstmals im Jahre<br />
1682 bezeugt; zuvor benutzte man ihn zur Bezeichnung einer ge<strong>ist</strong>igen Anlage oder eines Temperaments. Die bekannte<br />
Schrift von Lord Shaftesbury, Sensus communis: An essay on the freedom of wit and humour (1709), war eine der ersten, in<br />
der „humour“, <strong>Humor</strong>, in dem heute vertrauten Sinne verwendet wurde. Voltaire hingegen postulierte einen französischen<br />
Ursprung für den Begriff und nahm an, dass der englische Begriff „humour“ im neuen Sinne von „plaisanterie naturelle“ von<br />
dem französischen „Humeur“ abgeleitet sei, wie er von Corneille in <strong>seine</strong>n ersten Komödien verwendet werde. Tatsächlich<br />
leitete sich das englische Wort „humour“ ursprünglich aus dem Französischen ab und bezeichnete einen der vier<br />
hauptsächlichen Körpersäfte (Blut, Schleim, Galle und schwarze Galle), doch <strong>ist</strong> mehr als zweifelhaft, ob sich die<br />
zeitgenössische englische Bedeutung auch von Frankreich herleitete. Die Franzosen nämlich charakterisieren von 1725 an<br />
den Begriff immer umgekehrt als Entlehnung aus dem Englischen - ein Gebrauch, für den Voltaire ja ein indirekter Zeuge <strong>ist</strong>.<br />
Im Jahr 1862 sprach Victor Hugo noch über „jene englische Sache, die man <strong>Humor</strong> nennt“, und erst in den Jahren nach 1870<br />
sprachen einige Franzosen das Wort auf französische Weise aus.<br />
Einer ähnlichen Entwicklung kann man in anderen Ländern nachgehen. In der niederländischen Republik wurde noch im<br />
Jahre 1765 englischer <strong>Humor</strong> als etwas angesehen, „das man praktisch <strong>nur</strong> auf ihrer Insel findet“. Auch in Deutschland war<br />
das Wort „<strong>Humor</strong>“ ein englischer Import, wie Lessing ausdrücklich festhält. Tatsächlich übersetzte er „<strong>Humor</strong>“ zunächst als<br />
„Laune“ im älteren Sinne dieses Wortes, verbesserte sich dann aber später. Und noch 1810 bemerkte ein früher deutscher<br />
Biograph von Joseph Haydn, dass „eine Art unschuldiger Frechheit oder das, was die Briten humour nennen“, eine<br />
Haupteigenschaft des Charakters jenes Kompon<strong>ist</strong>en gewesen sei.<br />
Doch bedeutet die erste Erwähnung eines netten Begriffs nicht immer das Aufkommen eines neuen Phänomens, wie sich am<br />
deutschen „Witz“ ebenso veranschaulichen lässt wie am niederländischen „mop“. Beide verhältnismäßig späten Worte<br />
beschreiben ein Phänomen, das weit älter <strong>ist</strong> als der jeweilige Begriff, nämlich eine kurze Geschichte, die auf eine Pointe<br />
zuläuft. Solche Erzählungen waren bereits im 17.Jahrhundert gegenwärtig, aber der Begriff „Witz“ kommt erst am Ende des<br />
18., der gleichwertige Begriff „mop“ gar erst am Ende des 19.Jahrhunderts auf. <strong>Dies</strong>e Beispiele zeigen auch, dass bestimmte<br />
Begriffe wie Witz, Gag oder blague ihre eigene Geschichte haben und sich voneinander deutlicher unterscheiden können, als<br />
üblicherweise annimmt.<br />
Es wäre faszinierend, den verschlungenen Wegen des <strong>Humor</strong>-Begriffs und all der anderen humor<strong>ist</strong>ischen Begriffe<br />
nachzugehen, die aus dem Altertum auf uns gekommen oder in späteren Zeiten geprägt worden sind. Als Teil einer solchen<br />
Unternehmung könnten wir auf das Thema der „nationalen Stile“ zu sprechen kommen. Was etwa bedeutet es, wenn das<br />
französische Standard-Wörterbuch, der Robert, <strong>Humor</strong> als „forme d'esprit qui cons<strong>ist</strong>e á presenter ou á deformer la realité de<br />
manieré á en degager les aspeets plaisants et insolites“, definiert, während sein deutsches Gegenstück, der Duden, als<br />
Definition bietet: „Gabe eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den Schwierigkeiten und<br />
Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen“? Ein Teil dieses nationalen Stils <strong>ist</strong> es auch, andere<br />
Nationen als humorlos zu bezeichnen - so, wenn eine Figur in einem Roman von André Maurois behauptet, dass der<br />
mangelnde Sinn für <strong>Humor</strong> der einzige Grund dafür gewesen sei, dass die Deutschen den Erste Weltkrieg begannen.<br />
Obwohl <strong>Humor</strong> Lachen erzeugen sollte, <strong>ist</strong> nicht alles Lachen das Ergebnis von <strong>Humor</strong>. Lachen kann drohend wirken; ja, die<br />
Verhaltensforschung hat die Auffassung vertreten, dass das Lachen <strong>seine</strong>n Ursprung in einer aggressiven Zurschaustellung<br />
der Zähne hat. Andererseits kann <strong>Humor</strong> und das durch ihn hervorgerufene Lachen auch sehr befreiend wirken: Wir wissen<br />
<strong>Humor</strong>.doc angelegt 21.2.02 aktuell 04.08.02 Seite 45/68