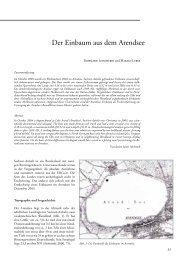Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sedimenten stecken. Da die Pfosten durch Komprimierung<br />
des Moorkörpers heute bis in die Grasnarbe durchdrücken,<br />
kann eine Einrammtiefe von mindestens 1,5<strong>–</strong>2m<br />
vorausgesetzt werden.<br />
Die Pfosten sind, soweit dies die Grabungschnitte erkennen<br />
lassen, vor allem in Dreier-Jochen gesetzt, so dass sich<br />
zweischiffige Firstdachhäuser (Satteldachhäuser) ergeben.<br />
Die Gebäude sind aufgrund ihrer Längen-Breiten-Verhältnisse<br />
recht schmalstirnig, so dass im Gegensatz zu den gängigen<br />
Proportionen jungneolithischer Gebäude mit einer<br />
gewissen Berechtigung von „Langhäusern“ gesprochen<br />
werden kann. Ein „genetischer“ Zusammenhang mit den<br />
Langhäusern alt- und mittelneolithischer Tradition besteht<br />
indessen nicht (siehe unten). Von der Dachkonstruktion<br />
fanden sich im Holzversturz keine sicher zuweisbaren<br />
Reste. Einige große Rindenbahnen könnten zur Dachdeckung<br />
gehört haben. Die Gebäude sind mit Holzfußböden<br />
ausgestattet, deren mehrlagiger Unterbau eine gewisse Bodenfreiheit<br />
von etwa 20<strong>–</strong>30 cm gewährte, so dass die Bodenbeläge<br />
vom feuchten Untergrund abgerückt waren. Es<br />
fehlt in allen Gebäuden jeglicher Nachweis von Fußbodenestrichen<br />
oder gar Wandlehmen. Vielmehr zeigen angebrannte<br />
Bodenhölzer um die Feuerstellen mehrfach, dass<br />
die Holzböden in ihrem Umfeld offen lagen. Die Befunde<br />
in Haus 1 belegen, dass der Boden zumindest partiell mit<br />
Rindenbahnen ausgelegt war. Zudem gibt der Befund der<br />
Nebenfeuerstelle des gleichen Hauses den Hinweis auf<br />
eine Bodenisolation durch eingebrachten Torf. An Außenwandkonstruktionen<br />
lassen sich liegende Hölzer in Pfostenzangen<br />
(Pfostenstangenwände, vielleicht auch Bretterwände)<br />
und stehende Stangenwände (Palisadenwände) erschließen.<br />
Diese Wände dürften, da Wandlehme gänzlich<br />
fehlen, mit Moos oder Torf abgestopft gewesen sein. Im<br />
Inneren gab es leichte Flechtwände. Nur die Feuerstellen<br />
sind mit Lehm gebaut und enthalten partiell Rindenbahnen<br />
und Steine.<br />
5.3.1 Hausbefunde im Einzelnen<br />
Haus 1<br />
Zweischiffiger Pfostenbau von 15 x 5 m Grundfläche. Die<br />
tief gegründeten Pfosten bestehen aus Rundlingen, Halblingen<br />
und Radialspältlingen von Eschenstämmen mit 10<strong>–</strong><br />
25 cm Durchmesser. Die Pfosten der Längswände stehen<br />
meist in Pfostenpaaren. Die Mittelpfosten stehen indessen<br />
einfach und bilden zusammen mit den Pfostengruppen<br />
der Wände insgesamt 9 Pfostenjoche, die in Abständen<br />
von ca. 2 m hintereinander gesetzt sind (Abb. 18). Lediglich<br />
im Mittelbereich des Hauses gab es im 6. Joch einmalig<br />
einen Jochabstand von nur 1 m, was mit der Plazierung<br />
der Feuerstelle in Zusammenhang steht.<br />
Es ist zu vermuten, dass die Pfostengruppen der Längswände<br />
liegende Prügel- oder Bretterwände im Sinne von<br />
Pfostenzangen zusammenhielten, von denen allerdings<br />
keine Elemente in situ angetroffen wurden. Darüber hinaus<br />
erlaubten die Doppelpfosten möglicherweise die Konstruktion<br />
eines halbstöckigen Dachgeschosses, in dem ein<br />
Pfosten die Konstruktion der Zwischendecke, der andere<br />
weiter hinaufreichend die Wandpfette trug. Die nordöstliche<br />
Giebelseite des Hauses zeigt durch <strong>kleine</strong>re Zwischenpföstchen<br />
einen klaren Wandabschluß. Dieser bestand offenbar<br />
aus vertikal gestellten Buchenstangen, die in das<br />
Gebäudeinnere hereingebrochen als Versturzlage auf dem<br />
Fußboden erhalten blieben (Abb. 19a).<br />
Die der Dorfstrasse zugewandte Giebelseite des Hauses hat<br />
eine nach innen verschobene Hauswand, so dass ein überdachter<br />
Eingangsbereich bestand. Fünf Pföstchen der<br />
Wandkonstruktion sind auf Höhe des zweiten Pfostenjoches<br />
erhalten. Klare Spuren einer Türöffnung sind nicht<br />
auszumachen, vermutlich lag sie im SO des Firstpfostens<br />
in gerader Flucht mit den anderen Türöffnungen im Gebäudeinneren.<br />
Die nach innen verschobene Giebelfläche<br />
Abb. 17 Seekirch-Stockwiesen.<br />
Haus 1 von SW, im Vordergrund<br />
die Substruktion der<br />
Dorfstraße (Foto LDA).<br />
25