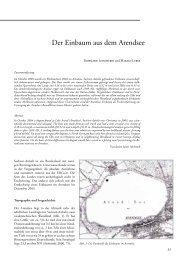Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Große Häuser – kleine Häuser
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abb. 47 Seekirch-Achwiesen. Hirschgeweih-Zwischenfutter. Hacke<br />
links), Zapfenfassungen (mitte) und Klemmschäftungen (unten).<br />
(Sa-RC 1 u. 2) und unverkohlte Detrituspartikel (Sa-RC<br />
3) zur Radiokarbondatierung entnommen worden. Die<br />
Daten liegen kalibriert (1σ) nach Stuiver und Kraeds recht<br />
einheitlich zwischen 2860 und 2490 v. Chr. (Abb. 45).<br />
Die Kulturschichten erwiesen sich als äußerst fundreich.<br />
Ganze Nester weitgehend anpassender Keramikbruchstücke<br />
lassen sich wieder zu vollständigen Gefäßen ergänzen.<br />
Dies ist, gemessen an den Erfahrungen z. B. mit den<br />
Brandschichten von Hornstaad, Wangen-Hinterhorn und<br />
Arbon-Bleiche 3 ein weiterer Hinweis auf einen Siedlungsbrand.<br />
Das Formenspektrum ist einheitlich der Goldberg<br />
III-Gruppe zuweisbar (Abb. 46). Unter der Grobkeramik<br />
fallen zahlreiche Stücke mit Textilabrollung (sog. Mattenrauhung)<br />
ins Auge. Zudem gibt es Lochränder und Leistenapplikationen.<br />
Die Feinkeramik hat Ritz- und Stichverzierungen,<br />
Knickschüsseln tragen Knubben und Leistensegmente<br />
am Umbruch. Dies ist zusammen mit der<br />
häufigen Textilabrollzier ein typologischer Hinweis auf<br />
eine jüngere Datierung innerhalb der Laufzeit von Goldberg<br />
III. Bei den Schüsseln von Alleshausen-Grundwiesen<br />
und Alleshausen-Täschenwiesen sitzen die Applikationen<br />
über dem Umbruch, wie auch die Knickschüssel aus der<br />
dendrochronologisch auf 2917<strong>–</strong>2856 v. Chr. datierten<br />
Schicht 15 von Sipplingen am Bodensee eine deutlich über<br />
dem Knick angebrachte Knubbe aufweist (KOLB 1999, 17<br />
Abb. 4,1).<br />
Die Fundschicht enthält eine reiche Hirschgeweihgeräteindustrie<br />
mit Abfall-, Halb- und Fertigprodukten, dabei<br />
Geweih-Zapfenfassungen (Abb. 47), Geweihhacken und<br />
eine Harpune (SCHLICHTHERLE 1999, 44 Abb. 11,3.12).<br />
Auch Knochengeräte und zahlreiche Holzgeräte sind optimal<br />
erhalten (SCHLICHTHERLE 1999, 45 Abb. 12,3<strong>–</strong>16). Es<br />
liegen mehrere Knie- und Stangenholme, Holzgefäße und<br />
Spaltkeile vor. Drei Teile von Wagenrädern mit Einschubleisten<br />
sind an anderer Stelle bereits ausführlich vorgelegt<br />
worden (SCHLICHTHERLE 2002). Die Steingeräte umfassen<br />
neben gestielten Silexpfeilspitzen auch Beilklingen aus<br />
Grüngestein und Edelserpentin sowie Mahlplatten und<br />
Mahlsteine. Die herausragenden Textilfunde stellt A.<br />
Feldtkeller (in diesem Band) in einem eigenen Beitrag vor.<br />
8. <strong>Häuser</strong> und Siedlungsstrukturen im Wandel<br />
8.1 <strong>Häuser</strong><br />
Die Gebäude der Aichbühler- und Schussenrieder Kultur<br />
in Aichbühl, Riedschachen, Taubried und Ehrenstein sind<br />
seit langem bekannt und konnten als die „klassischen“<br />
<strong>Häuser</strong> der jungsteinzeitlichen Feuchtbodensiedlungen in<br />
Oberschwaben gelten. Es sind ein- und zweiräumige, in<br />
seltenen Fällen auch dreiräumige Rechteckhäuser, die in<br />
Pfostenbauweise, partiell auch in Ständerbauweise errichtet<br />
waren. Feuerstellen und Backöfen gehören regelhaft zur<br />
Ausstattung und sind vor allem enlang der Wände positioniert.<br />
Während in Aichbühl zweischiffige Gebäude vorherrschen,<br />
fehlen in der Schussenrieder Kultur vermehrt<br />
die Mittelpfosten. Vor allem die <strong>kleine</strong>ren einzelligen Gebäude<br />
von Taubried I und Riedschachen II kommen auch<br />
ohne Mittelpfosten aus. Firstpfosten sind jedoch die Regel,<br />
so dass in den meisten Fällen von Satteldächern bzw.<br />
Rofendächern ausgegangen werden kann. Die <strong>Häuser</strong> sind<br />
durchweg in Holz-Lehmbauweise errichtet. Lehmestriche<br />
kleiden die auf Schwellholzlagen errichteten Holzfußböden<br />
aus, in Riedschachen sind sogar Estrichlagen ohne<br />
Holzunterbau nachgewiesen (STROBEL 2000, 204 ff.).<br />
Konstruktive Details, noch mit Lehmfüllung bei der Ausgrabung<br />
angetroffene Wandstummel und in Schadfeuern<br />
verziegelte Hüttenlehmfragmente machen deutlich, dass<br />
auch die Wände einen Lehmverputz hatten. Zumindest<br />
alle Flecht- und Stangenwände dürften so mit Lehm isoliert<br />
gewesen sein. Für gut gefügte Bohlen- und Palisadenwände<br />
sind auch einfache Abstopfungen mit Moos oder<br />
Gras denkbar. Da unterschiedliche Wandkonstruktionen<br />
nicht selten an ein und demselben Gebäude nachweisbar<br />
sind, können die <strong>Häuser</strong> auch kombiniert mit Lehmwänden<br />
und abgestopften Holzwänden gebaut gewesen sein.<br />
Die vielfach erneuerten Lehmestriche und weitere, als<br />
Wandversturz deutbare Lehmpackungen in den Siedlungsablagerungen<br />
machen jedenfalls deutlich, dass Lehm als<br />
Baumaterial in diesen Gebäuden des frühern Jungneolithikums<br />
eine wichtige Rolle spielte.<br />
Ähnliche Verhältnisse sind auch für das späte Jungneolithikum<br />
anzunehmen. Die ebenerdigen <strong>Häuser</strong> der Pfyn-<br />
Altheimer Gruppe Oberschwabens sind in Pfostenbauweise,<br />
meist zweischiffig mit mehrfacher Jochstellung der Pfosten<br />
errichtet. In Reute-Schorrenried liegen Estriche über<br />
Holzfußböden (MAINBERGER 1998, 28 ff.). In Ruhestetten-Egelsee<br />
blieben in den <strong>Häuser</strong>n 1 und 3 die hinteren<br />
Gebäudeteile estrichfrei (PARET 1955, 17 Abb. 6). Dies<br />
deutet wiederum eine Zweiteilung der <strong>Häuser</strong> an, wie<br />
auch in Reute Haus 1 durch einen Wechsel der Fußbodenlage<br />
eine zweikammerige Gliederung anzunehmen ist<br />
(MAINBERGER 1998, 33 Abb. 28). Leider sind die <strong>Häuser</strong><br />
von Ödenahlen nicht in der Fläche erkundet, doch lassen<br />
die Profilschnitte durch die <strong>Häuser</strong> 1<strong>–</strong>4 dicke Lehmlagen,<br />
in einer Bauphase des Hauses 2 auch eine Stangenwand<br />
erkennen (SCHLICHTHERLE 1995b, 26 ff.; Beilage 2<strong>–</strong>4). Die<br />
<strong>Häuser</strong> der Siedlungen der Pfyn-Altheimer Gruppe im<br />
Schreckensee und Steeger See waren in Pfostenbauweise<br />
errrichtet, sind der Befundlage nach zu urteilen aber ver-<br />
45